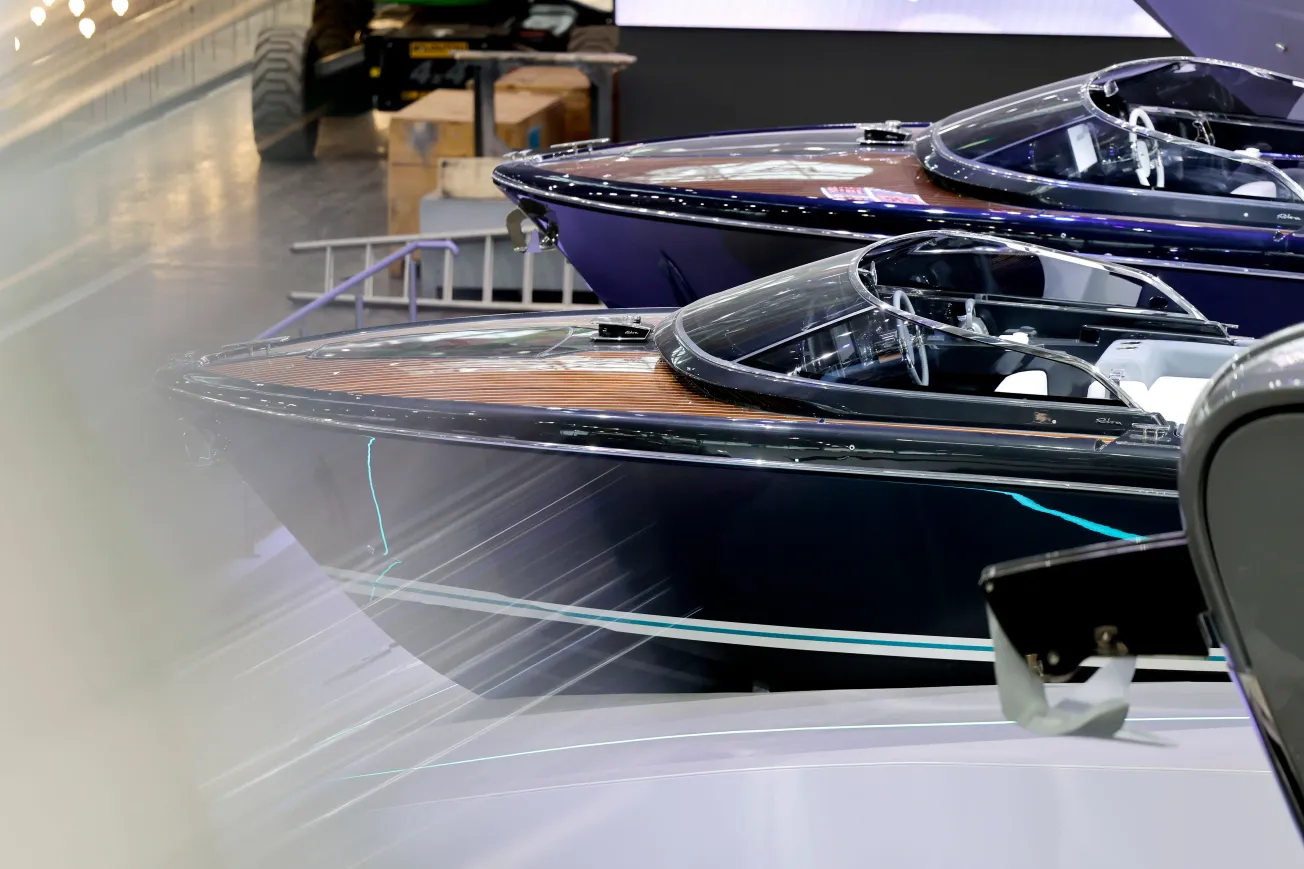Nach zwei Wochen ging am vergangenen Samstag die Klimakonferenz in Belém zu Ende. Die USA waren bei der Konferenz nicht vertreten, die anderen Staaten in zahlreichen Fragen gespalten. Die politische Lage spiegelt sich im ambitionslosen Abschlusstext wider. Drei Entwicklungen stechen dabei hervor.
1. Fossile Energien – nicht erwähnt
Das Abschlusspapier der COP beschreibt in zahlreichen Passagen die Notwendigkeit, Treibhausgase zu reduzieren. Die physikalische Ursache der Klimakrise, die fossile Energieproduktion, kommt in dem Text allerdings nicht vor. Das ist das Ergebnis erbitterter diplomatischer Auseinandersetzungen, bei denen sich Staaten, die primär auf fossile Energien setzen, etwa Russland oder Saudi-Arabien, durchsetzen konnten.
Zwischenzeitlich formierte sich eine breite Allianz aus dem globalen Norden und Süden, die sich für einen konkreten Fahrplan zur Abkehr von der klimaschädlichen Verbrennung von Öl, Gas und Kohle einsetzte. Die positive Dynamik wurde auch durch den brasilianischen Präsidenten Lula beeinflusst, der bereits in seiner Eröffnungsrede dafür appellierte, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu überwinden. Auch die Bundesregierung unterstützte einen Brandbrief an die Konferenzleitung. Dieser sollte den fossilen Ausstieg, obwohl er nicht auf der Agenda stand, in den Abschlusstext platzieren: »Wir können kein Ergebnis unterstützen, das keinen Fahrplan enthält für eine geordnete und gerechte Abkehr von fossilen Brennstoffen«. Schlussendlich wurde 27 Stunden nach geplantem Ende der Konferenz dieses Ergebnis trotzdem akzeptiert, wohl auch, weil eine COP ohne Abschlusstext den ohnehin fragilen Multilateralismus weiter untergraben hätte.
2. Klimaanpassung: Indikatoren und neue Finanzierungsziele
Ursprünglich sollte Klimaanpassung eines der zentralen Themen der Konferenz werden. Da das 1,5-Grad-Ziel kaum zu erreichen ist, werden notwendige Anpassungen – falls überhaupt möglich – immer umfangreicher und teurer. Auf der COP wurde ein Set an Indikatoren verabschiedet, die angeben sollen, wie weit sich Regionen an die Klimakatastrophe angepasst haben. Aufgrund von politischen Nachverhandlungen verloren die Indikatoren jedoch an Klarheit und sind eventuell schwer praktisch umsetzbar. Es ist zu erwarten, dass die Verhandlungen bei der nächsten COP weitergehen.
Das Finanzierungsziel für Klimaanpassungen wurde hingegen verdreifacht. So sollen sich auch arme Länder, die oft besonders von der Klimakrise betroffen sind, die Anpassung leisten können. Im Abschlusstext fehlt jedoch ein Basiswert – es ist somit potenziell unklar, welcher Wert verdreifacht werden soll. Die Verschiebung des Ziels ins Jahr 2035 entspricht zudem einer Abschwächung, das ursprüngliche Ziel galt für 2030.
Wie es um die tatsächliche Finanzierung von Klimaanpassung steht, lässt sich anhand des Klimaanpassungsfonds beobachten. Deutschland trug 60 Millionen zu dem Fonds bei, dennoch verpasste er sein Finanzierungsziel von 300 Millionen Dollar.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login