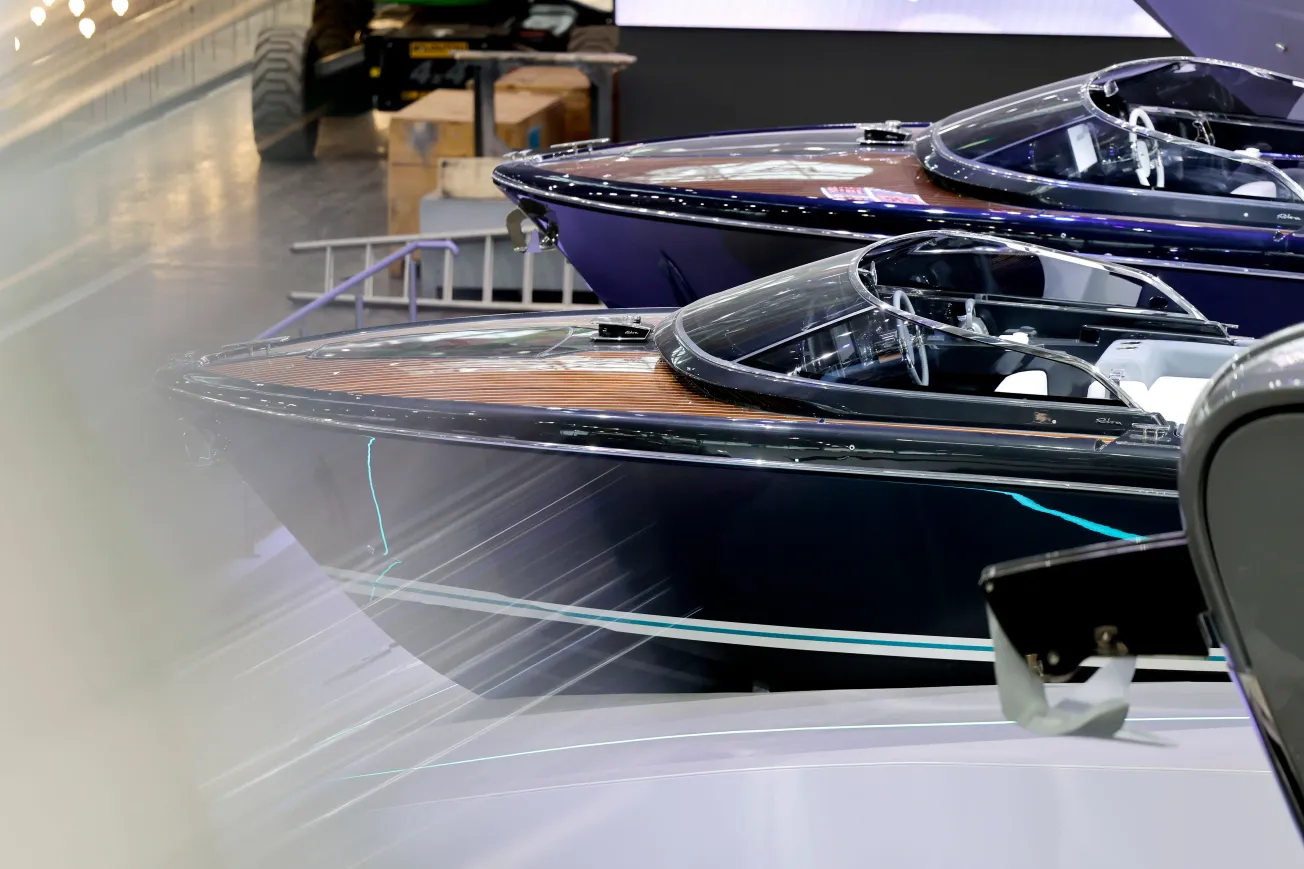Dauerhafte Temperaturen über 30 Grad, Tropennächte, die einem den Schlaf rauben, hitzebedingte Erschöpfung: Die Klimakrise ist längst in unserem Alltag angekommen. Doch manche Menschen müssen sich mehr, andere weniger an die immer höheren Temperaturen anpassen. 37 Grad sind noch aushaltbar, wenn man im kühlen Büro arbeitet, ein klimatisiertes Auto fährt und ein Pool im Garten steht. Schwieriger ist es, wenn man draußen und in der prallen Sonne arbeitet – oder zur Arbeit den überfüllten und überhitzten Bus nehmen muss – und auch Zuhause keinen Hitzeschutz hat. Gerade für alte Menschen ist das Ausharren in schlecht isolierten Wohnungen oft lebensbedrohlich. Einer aktuellen Studie zufolge hat die Klimakrise die Zahl der Hitzetoten in Europa verdreifacht. Rund 2.800 Menschen sind im vergangenen Jahr an Hitze gestorben. In dieser Situation sind Freibäder kein unpolitischer Freizeitspaß mehr. Sie gehören in Zeiten der Klimakatastrophe zur essenziellen Infrastruktur. Das Mindeste, wofür Regierungen aller Länder sorgen sollten, ist Abkühlung – und das für alle, unabhängig vom Geldbeutel.
1. Die Utopie
Es könnte alles ganz anders sein. Aus dem klimatisierten Büro ab ins Schwimmbad: Weit ist es nicht, die Anbindung über den öffentlichen Nahverkehr ist gut getaktet, im Bus muss man weder gedrängt stehen noch besonders schwitzen. Im Freibad angekommen, ist der Eintritt frei. Dort arbeitet gut ausgebildetes Personal in ausreichender Zahl, es gibt so viele Freibäder, dass in jedem genug Platz ist. Auch die knusprigen Schwimmbadpommes stehen für einen angemessenen Preis bereit. Auch die seit Kurzem wieder beschwimmbaren Flüsse in den Städten bieten Abkühlung. In Berlin sind die Spree und ihre Kanäle gereinigt, spezielle Badestellen sind eingerichtet worden. Unkompliziert kann man auf dem Heimweg noch schnell ins Wasser hüpfen, ohne durch ein Tor und Eintritt bezahlen zu müssen. Und möchte man sich nur fix abkühlen, ohne gleich in Badevollmontur schwimmen zu müssen, stehen auch dafür Wasserspielplätze und Brunnen in den Parks der Stadt bereit. Trinkwasser gibt es kostenlos an öffentlichen Brunnen, und Bäume finden sich in jeder Straße und spenden Schatten. Die Wohnungen sind energetisch saniert, die vielerorts eingebauten Wärmepumpen dienen im Sommer als Klimaanlage – alternativ helfen Ventilatoren oder reguläre Klimaanlagen. Auf der Straße lebt niemand. Auch in den einst betonierten Straßen der Innenstädte ist es deutlich angenehmer geworden, seitdem Wiesen und Bäume gepflanzt sowie Betonflächen entsiegelt worden sind. Es ist zwar heißer geworden, aber nicht so heiß wie befürchtet – denn die Regierungen der Welt haben sich endlich zusammengetan und die Klimakrise abgemildert.
2. Die Theorie
Mit einer so fundamentalen Veränderung der Umwelt, wie wir sie gerade erleben, müssen auch gesellschaftliche Systeme und Ideen neu ausgehandelt werden. Denn dass Menschen zu unterschiedlichen Graden dem Klimawandel und seinen Folgen ausgesetzt sind, ist weniger zufällig, als sozioökonomisch bedingt. »Verwundbarkeit ist das Ergebnis sozialer Praktiken, gesellschaftlicher (nicht selten rassistischer Zuschreibung und Verhältnisse)«, schreibt Kristina Dietz in ihrem Sammelband-Beitrag zu Klimavulnerabilität.
Die Vulnerabilität entspricht nicht nur rassistischer Diskriminierung, wenn wie im Beispiel von Dietz beim Hurrikan Katrina 2005 in New Orleans überproportional schwarze Menschen betroffen waren, weil sie eher in Vierteln lebten, die von staatlicher Vorsorge vernachlässigt werden. Innerhalb Deutschlands sind es Menschen mit niedrigem Einkommen, die in den heißesten Gebieten leben und noch dazu nicht ausreichend versorgt sind, um sich vor den Risiken zu schützen. Dass sich jedes Jahr Schlangen vor Berliner Schwimmbädern bilden und zeitweise sogar der Einlass gestoppt werden muss, ist ein Symptom dieser Ungleichverteilung. Denn das im Bundesschnitt überdurchschnittlich arme Berlin hat mit zwei Bädern pro 100.000 Einwohnenden besonders wenige Bäder. Besonders stark trifft die Hitze außerdem Menschen ohne Wohnung. Sie sind ihr quasi vollkommen ausgesetzt. Darüber hinaus sind manche menschliche Körper von sich aus anfälliger für Hitze: Alte und kranke Menschen sind eher gefährdet, aber auch Frauen stärker als Männer.