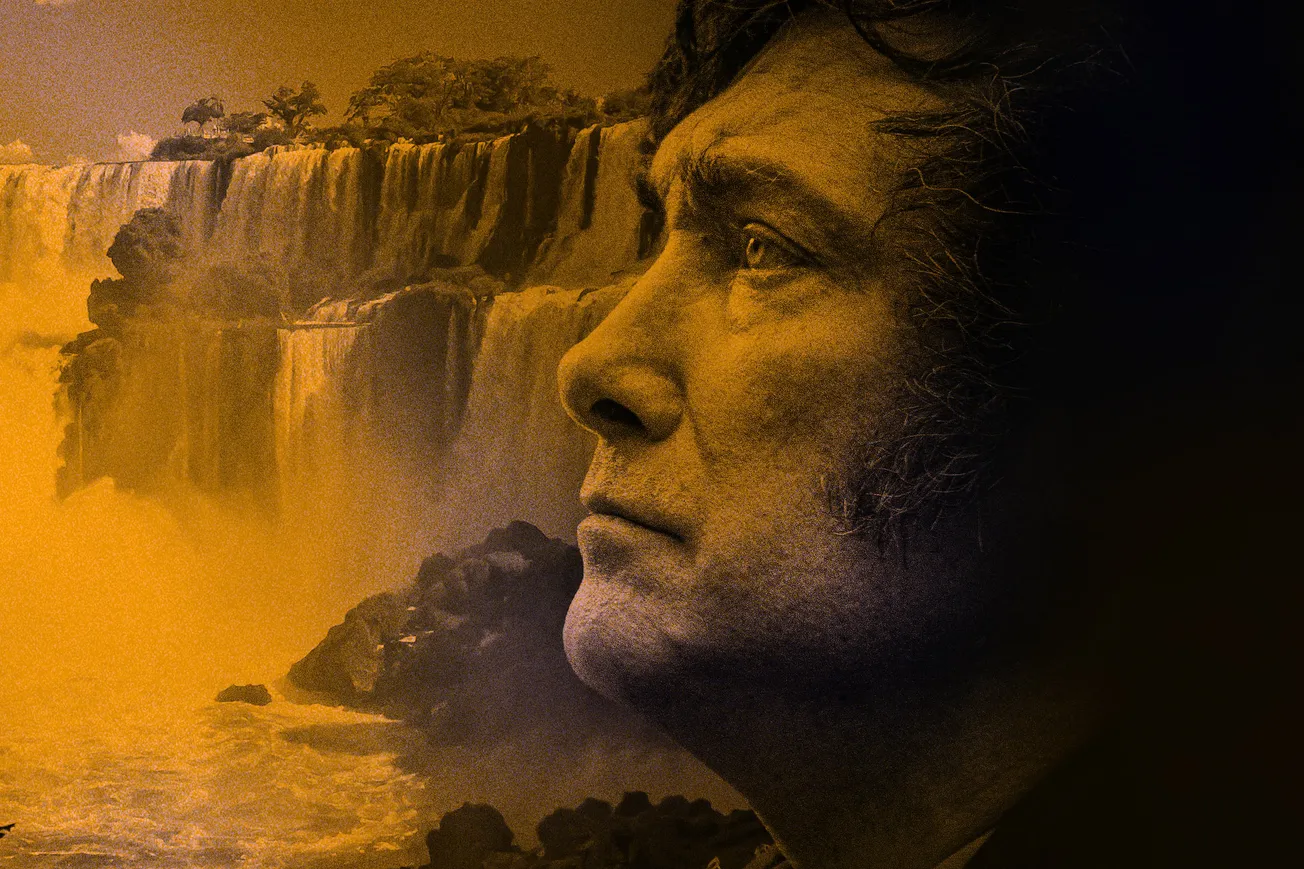Die Republik Malediven dürfte vielen Menschen aus Urlaubsprospekten oder der Werbung bekannt sein. Jene, die das Glück hatten, dort einen Urlaub zu verbringen, erinnern sich an schneeweiße Strände, türkisblaues Wasser oder schwärmen vielleicht von der atemberaubenden Tierwelt. Doch hinter diesen Bildern verbirgt sich eine hohe Verwundbarkeit, die viele kleine Inselstaaten der Welt miteinander teilen.
Die Republik Malediven ist ein aus 25 Korallenatollen bestehender Inselstaat im Indischen Ozean, südwestlich des indischen Subkontinents gelegen. Atolle sind ringförmige Korallenriffe, die eine Lagune umschließen. Mit nur 298 km² Landfläche und rund 1.192 Koralleninseln, die sich über 26 Atolle auf einer maritimen Fläche von fast 90.000 km² erstrecken, sind die Malediven eines der geografisch am weitesten verstreuten Länder der Welt. Nur etwa 190 Inseln sind dauerhaft bewohnt, auf rund 160 finden sich Ressorts für den Tourismus. Zugleich zählt das Land mit nur 541.000 Einwohnern zu den kleinsten Staaten der Welt.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Malediven ist eine Erfolgsgeschichte, allerdings eine wenig nachhaltige und resiliente. Insbesondere die hohen Abhängigkeiten vom Tourismus sowie die Bedrohung durch die Klimakrise hängen wie ein dunkler Schatten über Wirtschaft und Gesellschaft. Über 80 Prozent der Landesfläche liegen weniger als einen, 99 Prozent weniger als 5 Meter über dem Meeresspiegel. Mit einer durchschnittlichen Erhebung von nur 1,5 Metern haben die Malediven eine der niedrigsten nationalen Erhebungen weltweit – ein Umstand, der nicht nur infrastrukturelle Herausforderungen, sondern auch existenzielle Bedrohungen im Kontext des Klimawandels mit sich bringt. Selbst ein moderater Anstieg des Meeresspiegels könnte nämlich zur vollständigen Unbewohnbarkeit des Landes führen. Ob und inwiefern die Staatengemeinschaft es schafft, die Auswirkungen der Klimakrise zu begrenzen, ist für die Malediven damit eine existenzielle Frage – und zugleich eine, die das Land selbst nicht beeinflussen kann.
Einseitige wirtschaftliche Strukturen
Eine weitere Besonderheit der maledivischen Wirtschaft ist ihre starke Abhängigkeit vom Tourismus. Kurz vor der Coronapandemie, im Jahr 2019, war das Land mit 1,7 Millionen Touristen das zweitbeliebteste Reiseziel unter den kleinen Inselentwicklungsländern. Nur Jamaika (2,7 Millionen) zog mehr Touristen an. In den Malediven summieren sich die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus auf 57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). 95 Prozent der Exporteinnahmen aus Dienstleistungen werden über den Tourismus erzielt, 3 Prozent über den Transportsektor. Da der Dienstleistungssektor wiederum mehr als 91 Prozent der gesamten Exporte ausmacht, zeigt sich an dieser Stelle die überragende Bedeutung des Tourismus für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes.
Klimavulnerabilität auf der einen Seite, wirtschaftliche Abhängigkeiten auf der anderen: die Malediven sind mit dieser Herausforderung nicht allein. Viele der kleinen Inselentwicklungsländer teilen strukturell ähnliche Probleme, trotz der enormen Heterogenität unter ihnen. Und diese Inselstaaten eint, dass sie für sich genommen so klein sind, dass ihre Interessen auf weltpolitischer Bühne kaum Gewicht haben.

Gemeinsame Interessen, gemeinsame Forderungen
Aus diesem Grund haben sich die Malediven, als einer der am stärksten vom Klimawandel bedrohten Staaten der Welt, in einer Gruppe von Ländern organisiert, die in den letzten Jahrzehnten als Small Island Developing States (SIDS) internationale Sichtbarkeit erlangt haben. Die Idee, dass kleine Inselstaaten mit vergleichbaren strukturellen Herausforderungen gemeinsam auftreten sollten, entwickelte sich zwar bereits in den 1970er und 1980er Jahren im Kontext wachsender ökologischer und ökonomischer Unsicherheiten und Krisen. Doch erst Anfang der 1990er Jahre nahm die Idee eine konkrete politische Gestalt an.
Die Entstehung der SIDS als eigenständige Gruppe innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft geht auf die 1990er Jahre zurück. Inmitten einer Weltordnung, die nach dem »Ende der Geschichte« auf Freihandel, Finanzialisierung und Hyperglobalisierung ausgelegt war, machten kleine Inselstaaten darauf aufmerksam, dass ihre Interessen von dieser Agenda nicht nur übersehen, sondern existenziell bedroht wurden (auch wenn Länder wie die Malediven davon zunächst materiell profitierten).
Auf der ersten UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro wurde erstmals anerkannt, dass kleine Inselstaaten mit spezifischen, systemischen Risiken konfrontiert sind: begrenzte natürliche Ressourcen, extreme Abhängigkeit von Importen, geringe wirtschaftliche Diversifizierung, fragile Ökosysteme und hohe Anfälligkeit gegenüber Naturkatastrophen. Konkrete politische Verpflichtungen und Reaktionen allerdings, die sich aus diesen Risiken ergeben würden, blieben aus.
Zwei Jahre später folgte deshalb ein weiterer Schritt: Auf der Konferenz in Bridgetown wurde 1994 das Barbados Programme of Action (BPOA) verabschiedet. Anders als die allgemeinen Zielsetzungen von Rio 1992 arbeitete das BPOA die nötigen politischen und ökonomischen Maßnahmen aus, um die spezifischen Herausforderungen kleiner Inselstaaten effektiv anzugehen. Im Ergebnis stand ein umfassender Katalog an Maßnahmen, der 14 Handlungsfelder abdeckte, vom Küstenmanagement über die Wasser- und Energieversorgung bis hin zu Tourismus und Bildung. Damit legte das BPOA den Grundstein für die institutionelle Verankerung der SIDS in der globalen Umwelt- und Entwicklungspolitik. Spätere Programme wie die Mauritius-Strategie (2005) und der SAMOA Pathway (2014) entwickelten diesen Rahmen weiter.
Heute sind 39 Staaten als SIDS klassifiziert. Trotz ihrer für sich genommen kleinen Größe – insgesamt tragen sie lediglich 0,4 Prozent zum globalen BIP bei und stellen weniger als 1 Prozent der Weltbevölkerung – machen sie zusammen circa 20 Prozent der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen aus. Durch das hohe Maß an Koordination und Kooperation sind sie eine kohärente und sichtbare Stimme im internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs. Das Beispiel der SIDS zeigt, wie Defizite in der Größe durch enge Zusammenarbeit überwunden werden können, wenngleich die wirtschaftlichen Herausforderungen enorm bleiben.