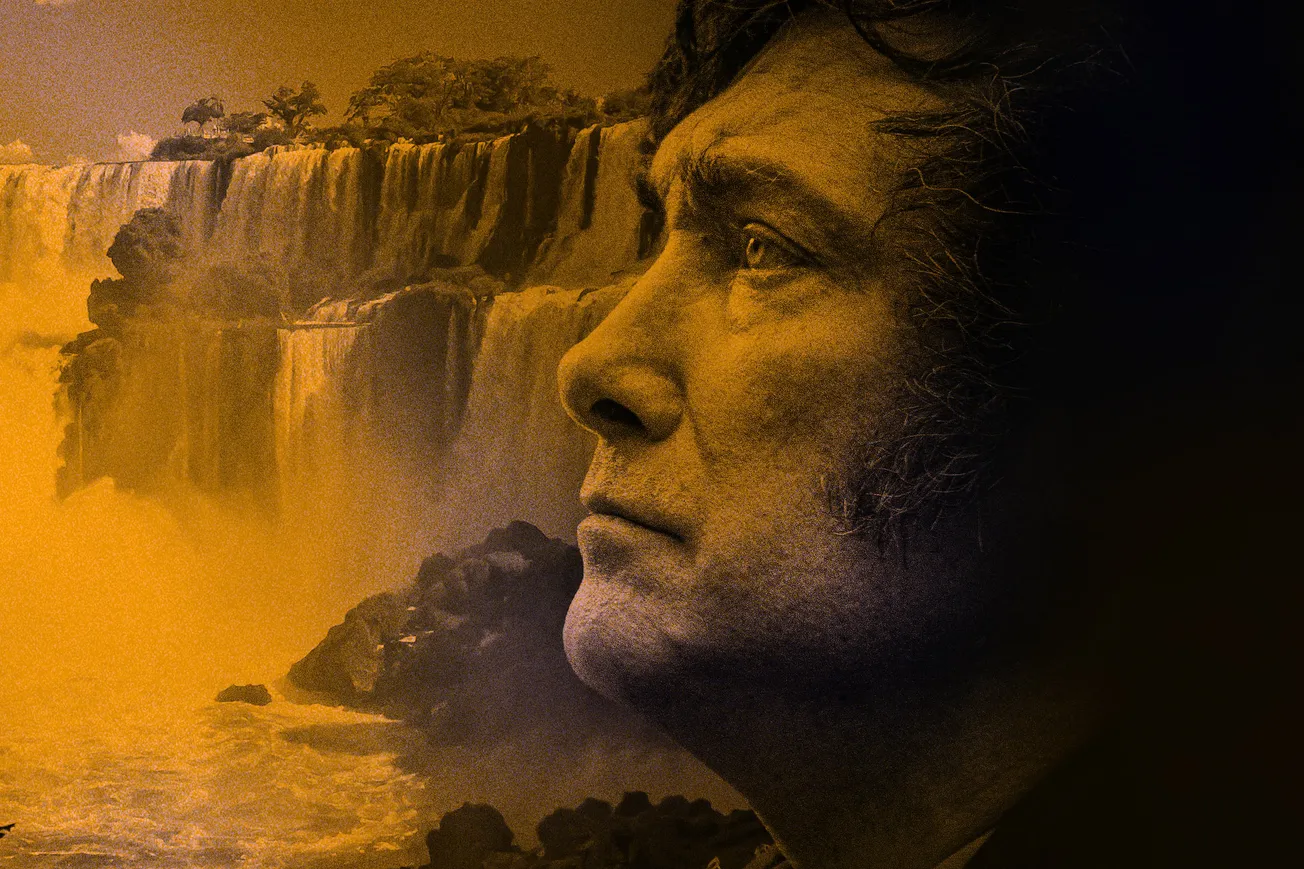Saudi-Arabien macht international immer wieder Schlagzeilen. Das Land richtet regelmäßig sportliche Großveranstaltungen aus, von Formel 1 bis E-Sports. Die Wirtschaftselite kauft sich auch mal einen Premier-League-Club und neben all dem entstehen neue Megaprojekte wie die futuristische Wüstenstadt NEOM. Ziel der politischen Elite ist es, das Image des Landes zu stärken und es als globalen Player zu etablieren. Und: Das Herrschaftshaus will die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes vom Öl verringern.
Saudi-Arabien gehört im 21. Jahrhundert ohne Frage zu den politisch und wirtschaftlich einflussreichsten Staaten des Nahen Ostens. Das Königreich wird seit der Festlegung seiner heutigen Grenzen 1926 von der Dynastie der Al Saud regiert, die trotz innen- und außenpolitischer Spannungen ihre Herrschaft über Jahrzehnte sichern konnte.
Das Öl war und ist der zentrale Motor der saudischen Wirtschaft und bestimmt nach wie vor die Geopolitik. Die Entdeckung der großen Vorkommen reicht bis in die 1930er Jahre zurück, also in die frühe Phase der Staatsgeschichte. 1933 erhielt die Standard Oil of California (heute Chevron) die erste Konzession für geologische Erkundungen. Geologen des Ölgiganten wie Max Steineke begannen fortan, in der kargen Wüstenlandschaft nach ungewöhnlichen Formationen zu suchen: merkwürdige Flussläufe, die sie bei den seltenen Regenfällen beobachten konnten, oder Hügel, die weder Wind noch Sand geformt haben konnten. Nach mehreren Rückschlägen führten schließlich einige Probebohrungen 1938 bei Dammam zum Erfolg. Beim siebten Versuch stieß man auf Gas und dann auf Rohöl – die Geologen waren auf das erste große und wirtschaftlich förderbare Ölfeld gestoßen. Mit »Dammam No. 7«, später bekannt als »Prosperity Well« (also »Quelle des Wohlstands«), begann die kommerzielle Erdölförderung.

Öl für Sicherheit
Im Februar 1945 – noch bevor viel größere Ölfelder wie das Ghawar-Feld (1948) entdeckt wurden, aus dem bis heute 70 Milliarden Barrel Öl gefördert wurden (weitere 50 Milliarden Barrel werden unter der Erde vermutet) – schlossen US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der saudische König Abdulaziz Ibn Saud den sogenannten »Öl-für-Sicherheit«-Deal. Im Kern des Abkommens stand ein beidseitig vorteilhafter Tausch: Saudi-Arabien sicherte den USA einen zuverlässigen Zugang zu seinen Ölreserven, während die Vereinigten Staaten dem saudischen Königshaus Schutz vor regionalen Bedrohungen und Unterstützung bei der Wahrung seiner territorialen Integrität zusicherten. Dieses Arrangement ermöglichte es den USA, ihre militärische Präsenz im Nahen Osten auszubauen und gleichzeitig die Kontrolle über die Ölressourcen der Region zu sichern.
In den 1980er Jahren festigte sich die strategische Bedeutung Saudi-Arabiens in der US-amerikanischen Außenpolitik. Mit der sogenannten Carter-Doktrin legten die USA fest, notfalls auch militärisch ihre Interessen im Nahen Osten zu verteidigen. Und so hielten US-Truppen während des Iran-Irak-Kriegs die Straße von Hormus offen, eine wichtige Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean. Dieses Sicherheitsversprechen zeigte seine Wirkung erneut während des Golfkriegs 1991, als amerikanische Soldaten saudische Ölfelder verteidigten, während Saudi-Arabien finanzielle und logistische Unterstützung lieferte.
Erst in jüngerer Zeit hat Saudi-Arabien begonnen, sich von der Abhängigkeit von den USA zu lösen. Besonders nach dem Drohnenangriff 2019 auf saudische Ölanlagen, auf den Washington nur eingeschränkt reagierte, wuchs das Misstrauen gegenüber der US-Sicherheitsgarantie. Gleichzeitig intensiviert das Königreich seine Beziehungen zu China, normalisiert den Kontakt zu Iran und tritt der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit bei, was die strategische Orientierung in Richtung Asien verstärkt. Dies wiederum weckt das Misstrauen und den Unmut auf US-amerikanischer Seite. Die Biden-Administration missbilligte zudem die Rolle Saudi-Arabiens im brutalen Krieg gegen den Jemen und die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi. Als im Zuge der Erholung nach der Covid-19-Krise und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Ölpreise und die Inflation in die Höhe schossen, musste US-Präsident Biden allerdings den »Gang nach Canossa« antreten. Er bat den saudischen Kronprinzen und Premierminister Mohammed bin Salman Al Saud, die saudische Ölförderung zu erhöhen, um die Preise zu stabilisieren und damit den Unmut der amerikanischen Wählerschaft zu dämpfen.
Das Öl bringt den Aufschwung
Der wirtschaftliche Aufstieg Saudi-Arabiens setzte ab Mitte der 1950er und mit Beginn der 1960er Jahre ein. Steigende Einnahmen aus der Ölproduktion ermöglichten eine stetige Entwicklung des Staatsapparates und der Infrastruktur. Ein wesentlicher Faktor dabei war die Gründung der Organisation erdölexportierender Länder (des sogenannten OPEC-Kartells) im Jahr 1960. Es erlaubte den Mitgliedstaaten, die Ölpreise zu kontrollieren und dadurch die Deviseneinnahmen zu steigern – was vielen anderen Entwicklungsländern verwehrt blieb, die ihre Rohstoffe in den globalen Norden exportieren. Durch den anziehenden Ölboom bildete sich eine neue Geschäftselite aus Familien, die durch Nähe zur Dynastie profitieren konnte.
Einen enormen Schub erlebte dieses Wachstumsmodell dann in den 1970er Jahren. Zunächst drosselten arabische Staaten ihre Ölproduktion, um die westlichen Staaten für ihre Unterstützung Israels im Jom-Kippur-Krieg (1973) zu sanktionieren, was den Ölpreis und die Inflation in den Industrieländern in die Höhe schießen ließ. Ein weiterer Preisschub erfolgte im Zuge der iranischen Revolution 1979, die die Ölproduktion im Iran stark einschränkte und die Region destabilisierte. Die Furcht vor Versorgungsengpässen trieb die Weltmarktpreise weiter nach oben.
Die Ölrenten im Verhältnis zum BIP – vereinfacht gesprochen der Gewinn, den ein Land aus der Ölproduktion zieht – stiegen in dieser Zeit rasant an und erreichten 1979 mit rund 87 Prozent des BIP ihren historischen Höhepunkt. Bis zur Jahrtausendwende stabilisierten sich die Ölrenten bei durchschnittlich 30 Prozent des BIP. Mitte der 2010er Jahre sorgte ein neuer Rohstoffboom wieder für erhöhte Renten von durchschnittlich 40 Prozent des BIP, der erst mit der Covid-Krise ein Ende fand.