Sven Beckert ist Historiker und Professor an der Universität Harvard. Nach seinem letzten Buch King Cotton über den Grundstoff der ersten industriellen Revolution legt er in seinem neuesten Werk Kapitalismus –Geschichte einer Weltrevolution eine Globalgeschichte des Kapitalismus vor. Im Interview mit Surplus-Redakteur Max Hauser fordert er eine fundiertere Auseinandersetzung mit dieser historischen Epoche.
Max Hauser: Was kann eine globale Geschichte des Kapitalismus leisten, was die bisherige Geschichtsschreibung nicht konnte?
Sven Beckert: Wir setzen uns seit 200 Jahren mit der Geschichte des Kapitalismus auseinander, aber die Erzählung ist noch immer sehr stark auf Europa und Nordamerika konzentriert. Es ist eine der letzten eurozentrischen Geschichten, die wir erzählen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob sie sich links oder rechts positionieren, verstehen die Geschichte des Kapitalismus als eine Geschichte Europas sowie europäischer Ausgründungen wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Dies ist eine völlige Missinterpretation. Man kann die Geschichte des Kapitalismus ausschließlich aus einer globalen Perspektive verstehen – nicht erst für die Gegenwart, sondern bereits in der Phase seiner Entstehung und Ausbreitung. Das Buch beginnt entsprechend im Hafen von Aden, Jemen, im Jahr 1150, und endet vor einer Textilfabrik in Kambodscha im Jahr 2023. Heutzutage ist klar, dass die dynamischen kapitalistischen Ökonomien nicht in Europa zu finden sind, sondern in Asien. Allein dieses Faktum stellt die gesamte Geschichte, die wir bis jetzt über den Kapitalismus geschrieben haben, infrage. Mit diesem Buch will ich einen Beitrag dazu leisten, die Welt, in der wir heute leben, zu verstehen – und den real existierenden Kapitalismus.
Bei einer globalen Geschichte über fast 1000 Jahre: Wie halten Sie Ursache und Wirkung in Ihrem Buch zusammen und verhindern, dass es eine lose Sammlung von Anekdoten aus aller Welt wird?
Das ist ein Problem, denn in den letzten 1000 Jahren ist auf der Welt natürlich viel Interessantes passiert. Das hilft uns allerdings im Verständnis des Kapitalismus nicht weiter. Ich bin in dem Buch so vorgegangen, dass ich für einen gegebenen Zeitpunkt versucht habe zu bestimmen, was die entscheidenden Fragen sind, um diesen Moment im Kontext der Gesamtgeschichte zu verstehen. Dazu habe ich mir dann Personen, Institutionen oder Orte herausgesucht, in denen sich die Fragen der Zeit exemplarisch verdichten, wo die historische Dynamik greifbar wird. So wechsele ich dann ständig zwischen einer globalen und lokalen Perspektive.
Ein gutes Beispiel dafür ist ein Unternehmer aus dem Saarland, Hermann Röchling. Er war ein großer Stahlindustrieller und durch die Analyse seiner Biografie, seiner politischen und unternehmerischen Aktivitäten, und auch die Analyse seiner Arbeiterschaft, kann ich sehr gut zeigen, wie sich die Dynamik der zweiten industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts entfaltet hat. Und ich kann bei der Frage, wie der Kapitalismus sich in verschiedenste politische Regime einfügt, zeigen, wie dieser Hermann Röchling dem Autoritarismus sehr zugeneigt war. Er hat sich im Ersten Weltkrieg persönlich dafür eingesetzt, dass Deutschland alle möglichen Eisenerzvorkommen und Kohleminen aus besetzten Gebieten zugeschlagen bekommt. Im Zweiten Weltkrieg hat er als Nazi-Funktionär wieder das Gleiche getan. Ich erzähle die Geschichte nicht nur, weil der Mann und das Unternehmen an sich interessant sind, sondern weil sie exemplarisch für die zweite industrielle Revolution stehen.
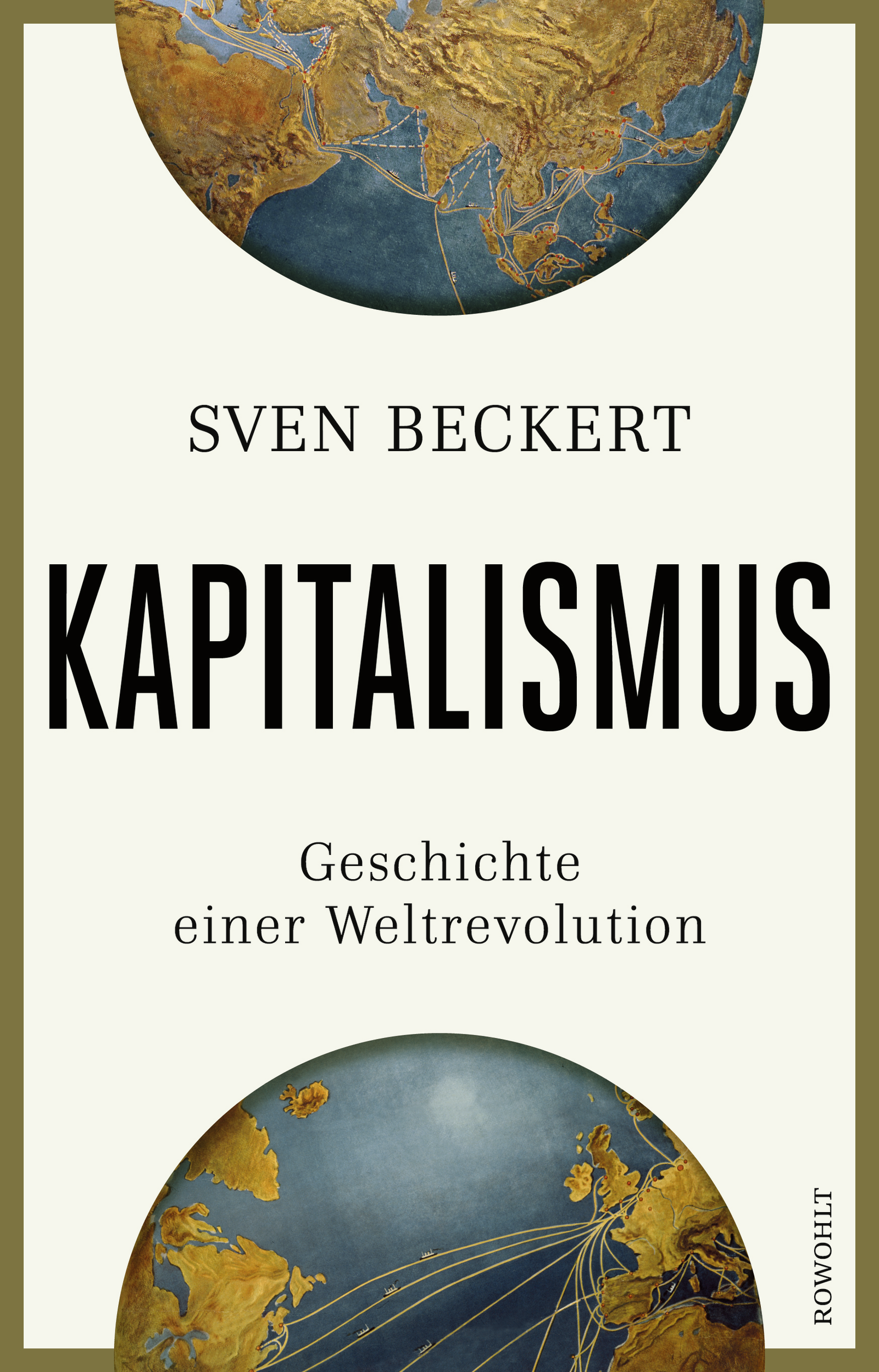
Sven Beckert: Kapitalismus
Geschichte einer Weltrevolution. 11. November 2025, Rowohlt Verlag.
Wie definieren Sie den Kapitalismus?
Zunächst hebe ich den historisch spezifischen Charakter des Kapitalismus hervor. Es ist keine »natürliche« Art des Wirtschaftens, sondern markiert einen radikalen Wandel in der Weltgeschichte: Kapitalismus bedeutet permanente Revolution. Das heißt, dass er nicht über Konzepte definiert werden kann, die es schon viel länger gegeben hat. Zum Beispiel wird der Kapitalismus oft mit Märkten gleichgesetzt, aber soweit ich das überblicken kann, gibt es keine menschliche Gesellschaft, in der es nicht in irgendeiner Form auch Märkte oder Handel gegeben hat. Auch die Anhäufung von Reichtum an sich ist kein Alleinstellungsmerkmal des Kapitalismus. Man denke nur an die vielen Kirchen, Schlösser und Burgen, die im feudalen Europa gebaut worden sind.
Ich definiere den Kapitalismus stattdessen als ein System des Wirtschaftens, in dem privat besessenes Kapital mit dem Ziel investiert wird, mehr Kapital zu produzieren. Es geht in erster Linie immer darum, das eingesetzte Kapital zu vergrößern, und nicht etwa mehr Textilien oder Nahrungsmittel zu produzieren, obwohl das in der Regel eine Nebenfolge ist. Daher ist der Kapitalismus an sich immer expansiv. Er dehnt sich räumlich, über immer mehr Gebiete, und lebensweltlich, über immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens aus. Kapitalismus setzt weiter voraus, dass alle Inputs und Outputs der Produktion selbst als Waren auf Märkten gehandelt werden. Das heißt, sie müssen kommodifiziert, zur Ware gemacht worden sein. Der wichtigste Input ist dabei die menschliche Arbeitskraft. Ich betone dabei stark den undogmatischen Charakter des Kapitalismus, wie er trotz einer unglaublichen Vielfalt und Wandlungsfähigkeit diesen Kern beibehält. Die Plantageninsel Barbados im Jahre 1750 und Stuttgart im Jahre 1950 sind radikal andere Gesellschaften, aber eben beide kapitalistisch.
Wenn der Kapitalismus so radikal ist, wie Sie sagen: Wieso wird das immer erst in der historischen Perspektive deutlich? Während wir darin leben, fühlt es sich wie das Normalste der Welt an.
Ich vergleiche das gerne mit Fischen, die kein Bewusstsein für das Wasser haben, in dem sie schwimmen. Ich glaube, so ist der Kapitalismus heute für viele von uns. Von der Weltgeschichte bis zu unserem Intimleben betrifft der Kapitalismus die großen Fragen unseres Lebens. Weil er in fast alle Bereiche unseres Lebens vorgedrungen ist, können wir denken, dass es die natürliche Ordnung der Welt ist. Was das Buch zeigt, ist, dass diese natürliche Ordnung in Wahrheit eine radikale Innovation ist, etwas völlig Neues in der Menschheitsgeschichte.
Ein Thema, das Sie behandeln, ist das Verhältnis von Staat und Kapital. Heutzutage fassen das viele als Gegensatz auf und behaupten, dass der Staat den Kapitalismus behindern würde. Wie sehen Sie das?
Das Verhältnis zwischen Staat und Kapital hat sich über die letzten Jahrhunderte natürlich entscheidend verändert. Der entscheidende Punkt ist, dass der Staat für die Entwicklung des Kapitalismus konstitutiv war. Die Idee, dass der Staat irgendwie in Opposition zum Kapital steht, dass er ihn an seiner Ausbreitung hindert, ist völlig ahistorisch, sogar lächerlich. Einen Kapitalismus ohne den Staat hat es nie gegeben. Das mag theoretisch, in extremer Abstraktion, möglich sein, aber ich untersuche den real existierenden Kapitalismus, und in dieser Geschichte spielte der Staat immer eine zentrale Rolle. Nehmen wir das Beispiel eines normalen städtischen Wochenmarkts. Wann öffnet der Markt? Wann schließt der Markt? Wer darf auf dem Markt verkaufen? Wer überprüft die Gewichte? Was passiert, wenn sich Käufer und Verkäufer streiten? Ein Wochenmarkt ist ein einfaches Beispiel, aber schon da ist der Staat konstitutiv. Bei komplizierteren Märkten wie für Arbeit ist der Staat entsprechend umso mehr eingebunden, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man eine Grafik des Wachstums des Nationalstaats und des Kapitalismus zeichnen würde, wären das zwei parallel verlaufende Linien.
Sie schreiben, dass die Dekolonialisierung vielleicht das prägendste Merkmal des Kapitalismus des 20. Jahrhunderts war. Das ist wahrscheinlich für viele in Deutschland eine neue Perspektive.
Das ist eine neue Perspektive, weil wir in Europa selbstbezüglich auf europäische Geschichte fokussiert sind. Das ist nicht völlig falsch – natürlich war Europa wichtig für den Kapitalismus, aber er war zu jedem Zeitpunkt seiner Geschichte in globale Verbindungen eingebettet. Ohne sie uns anzusehen, verpassen wir große Veränderungen in der Welt. Die Dekolonialisation der 1950er und 1960er Jahre ist zentral für das Verständnis der Gegenwart, weil ehemals kolonialisierte Länder wie China und Indien die dynamischsten Volkswirtschaften des 21. Jahrhunderts sind. Großbritannien hat die indische Wirtschaft als Kolonialmacht so strukturiert, dass sie den Interessen der Kolonialherren diente, nicht der indischen Kapitaleigner – oder gar der Bevölkerung. Das hatte langfristige negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Staat und Infrastruktur. Die Dekolonialisierung war der Moment, an dem neue Zentren der Staatsmacht entstanden, nämlich die postkolonialen Staaten. Sie schuf damit die Grundbedingungen für die kapitalistische Entwicklung dieser Regionen der Welt. Die Verschiebung des Machtzentrums des Kapitalismus von (Europa über) Nordamerika nach Asien ist eine der wichtigsten Entwicklungen der Gegenwart, die man nur durch eine Analyse der Dekolonialisierung verstehen kann.




