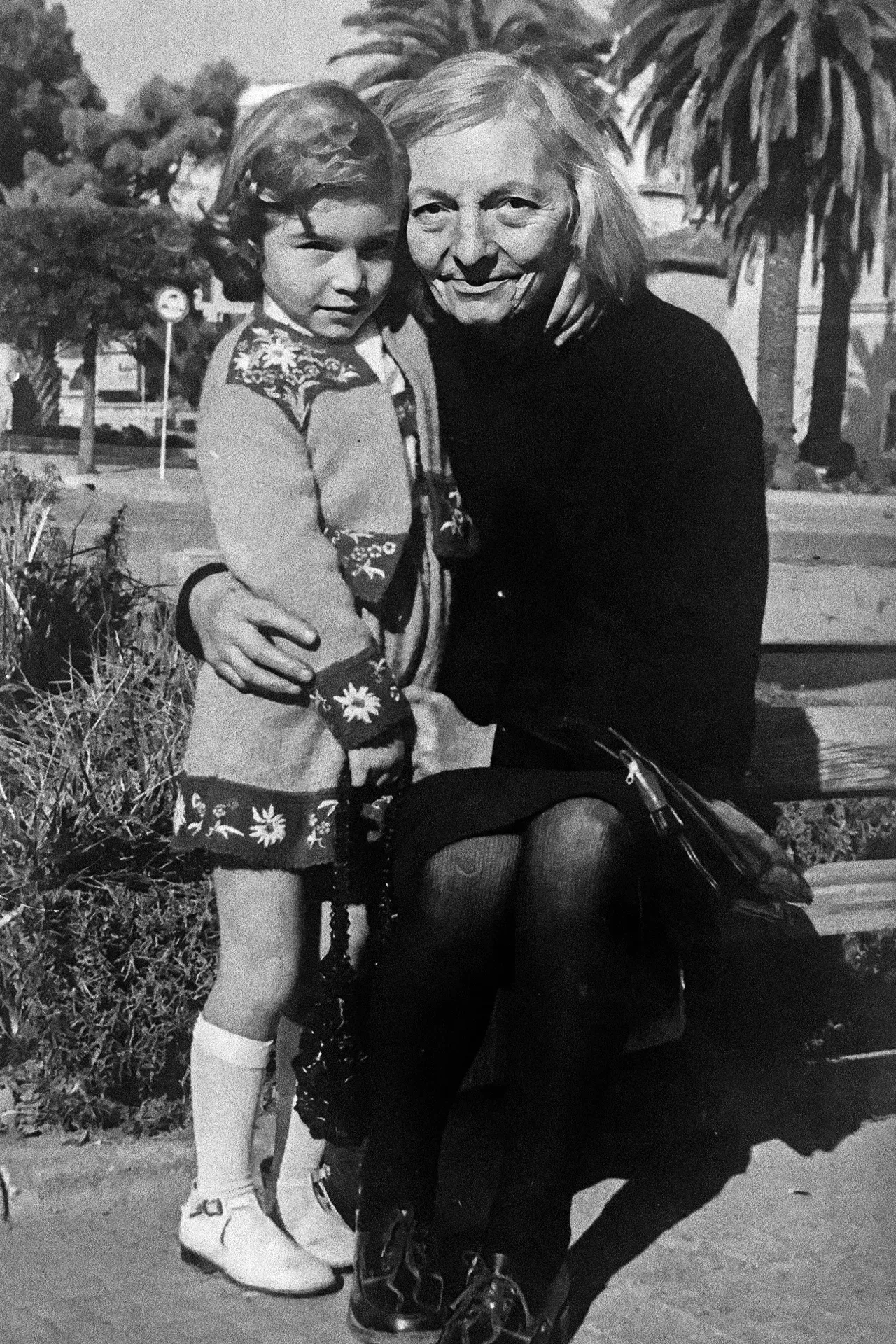In ihrem neuen Buch Aufrecht blickt Lea Ypi auf die Lebensgeschichte ihrer Großmutter Leman. Sie rekonstruiert eine Biografie, in der sich politisch-ökonomische Umwälzungen überlagern. Im Surplus-Interview spricht Ypi darüber, wie die neoliberale Schocktherapie Albanien zerstörte und warum eine Kritik des Kapitalismus die Voraussetzung für Freiheit und Würde ist.
Maxine Fowé: In Ihrem ersten Buch Frei beschreiben Sie Ihre Kindheit unter der kommunistischen Diktatur von Enver Hoxha in Albanien. Wie hat sich der plötzliche Übergang zum Kapitalismus angefühlt?
Lea Ypi: Wie es sich angefühlt hat, hing von der Generation ab. Für Menschen meiner Generation, die ihre Kindheit im Kommunismus verbracht hatten, war es traumatisch. Wir waren Kinder; wir hatten nicht die Zensur und politische Unterdrückung erlebt, die Erwachsene erfahren hatten, aber plötzlich waren alle Institutionen, die unser Leben geprägt hatten, verschwunden. Unser Leben war geprägt worden von der Partei, vom Kult um Enver Hoxha, von Behörden, die behaupteten, die Arbeiterklasse sei der zentrale Akteur der Geschichte. Plötzlich ging es um Zivilgesellschaft, Privatisierung, individuelle Eigentumsrechte, Märkte. Marx und Engels wurden buchstäblich in Stücke gerissen und durch Popper und Hayek ersetzt. Es war sehr schwer, sich zu orientieren.
Inwiefern war es für die ältere Generation anders?
Für Menschen, die älter waren als ich, war dies in gewisser Weise das, was sie wollten – oder was interpretiert wurde als das, was sie wollten: eine freie Marktwirtschaft. Aber ich glaube nicht, dass die Dissidentenbewegungen von 1989 bis 90 sich vollständig darüber im Klaren waren, dass sie eine private Wirtschaft und ultraliberale kapitalistische Strukturen wollten. Leider wurde die Freiheit eines unkontrollierten freien Marktes verwirklicht – und genau das ist das Problem.
Die Menschen sehnten sich nach der Freiheit, die eine kapitalistische Gesellschaft versprach?
In den 1990er Jahren hatten die Menschen plötzlich die Freiheit, alles zu tun, was sie wollten: Man konnte vom Dorf kommen, Land besetzen und sein Haus bauen, ohne Rücksicht auf die Allgemeinheit oder die Öffentlichkeit zu nehmen. Der öffentliche Raum wurde in einem chaotischen, unkontrollierten Wettlauf privatisiert, was zu sozialen Integrations- und Wirtschaftsproblemen führte. Es herrschte Misstrauen gegenüber dem Staat, das mit dem kommunistischen Erbe zusammenhing. In Verbindung mit der Aggressivität von Menschen, die unter schwierigen Umständen zu überleben versuchten, zerstörte dies den öffentlichen Raum und das Zugehörigkeitsgefühl dazu. Das Ethos lautete nun: Ich kümmere mich um mich selbst und meine Familie; ich kann niemand anderem vertrauen. Es war eine »Bottom-up-Privatisierung«. Und das ging einher mit der Zerstörung staatlicher Unternehmen und Institutionen – der Grundlage der wirtschaftlichen Produktion. Wir entwickelten uns von einem Land, das versuchte, alles zu produzieren, um zu überleben – einschließlich Nägel, Plastik, Flip-Flops –, zu einem Land, das fast nichts mehr produzierte. Staatliche Unternehmen wurden privatisiert, oft von ehemaligen Parteifunktionären oder in Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren.
Das dauert bis heute an: Jared Kushner und Ivanka Trump haben sogar eine ganze Insel in Albanien privatisiert und wollen dort ein Luxusresort bauen.
Wir erleben im postkommunistischen Albanien die extreme Privatisierung von allem, manchmal von unten durch verzweifelte Einzelpersonen, manchmal von oben durch einen Staat, der die Kontrolle über die Gemeingüter verloren hat und andere zum Investieren bewegen will.
Was geschah mit den Menschen in materieller Hinsicht, als der Kapitalismus mit einer massiven Schocktherapie eingeführt wurde?
Die Schocktherapie hatte enorme soziale Kosten und führte zu Arbeitslosigkeit: Staatsbetriebe wurden geschlossen, Menschen verloren ihre Arbeit, sie konnten nichts dagegen tun. Es kam zu Auswanderungen, die Familien auseinanderrissen. Ärzte und Lehrer aus Albanien wurden im Ausland zu Reinigungskräften oder Busfahrern – hochqualifizierte Menschen, die sehr einfache Arbeiten verrichteten. Sie wurden nicht als das anerkannt, was sie waren. Angesichts der Demütigung und Ausbeutung entschieden sich viele für illegale Geschäfte: Menschenschmuggel, Sexarbeit – zum Teil unter Zwang –, Drogenschmuggel. Wir gehen oft davon aus, dass nur »böse« Menschen so etwas tun, aber viele begannen damit, weil sie unter den Übergangsbedingungen zum Kapitalismus keine andere Wahl hatten.
Eine weitere Katastrophe waren landesweite Schein-Sparverträge, die unreguliert wuchsen und die Ersparnisse einer gesamten Generation vernichteten.
Diese Pyramidensysteme waren die Spitze des Eisbergs. Die Menschen verloren ihre gesamten Ersparnisse. Man hatte ihnen gesagt: »Wenn ihr spart und investiert, verantwortungsvolle finanzielle Entscheidungen trefft, werdet ihr belohnt.« Sie sparten und steckten alles in Pyramidensysteme – und verloren alles. Das war ein großes Trauma, und die Menschen hatten keine inneren Kategorien, um es zu verarbeiten.
Sie beschreiben den Alltag im kommunistischen Albanien mit nächtelangen Warteschlangen für alltägliche Güter. Was änderte sich, als auf Rationierung eine Wirtschaft der Preise folgte?
Alles wurde zu einer Transaktion. Eine Wirtschaft der Knappheit kann eine Wirtschaft der Solidarität sein: Du hast etwas nicht, ich habe etwas, wir teilen uns den Raum, wir sitzen im selben Boot. Man kann keine Dienstleistungen kaufen, also verlässt man sich bei der Kinderbetreuung auf Großeltern, Nachbarn, Onkel. Die Solidarität der Gemeinschaft hilft einem, mit Widrigkeiten fertig zu werden. Wenn sich das Ethos so verändert, dass man für alle seine Entscheidungen selbst verantwortlich ist, wird Armut zur Eigenverantwortung, nicht zu der des Staates. Es wird schwierig, um Hilfe zu bitten. Wenn Sie arbeiten und Kinderbetreuung brauchen, kaufen Sie sich einen Babysitter; Sie bezahlen eine Putzfrau. Hilfe wird zu einer Transaktion und zu einer Ware. Beim Übergang von Knappheit und Solidarität zu einer rücksichtslosen Transaktionswirtschaft schämten sich diejenigen, die zu kämpfen hatten oder arbeitslos waren; es gab kein Gefühl der Anerkennung. Scham war damals ein großes Gefühl.
Sie erinnern sich auch daran, wie leere Coladosen als Statussymbole in Fenstern zur Schau gestellt wurden.
Das Albanien, in dem ich aufgewachsen bin, war ein Ort mit starker Ideologie und einer kontrollierten Wirtschaft – Fünfjahrespläne. Und es gab nicht wirklich eine Auswahl für die Verbraucher; es gab nur das, was produziert werden sollte. Die meiste Zeit bereiteten wir uns auf den Krieg vor. Daher waren Konsumgüter aus dem Westen im Kommunismus Statussymbole – Zeichen dafür, dass man es irgendwie geschafft hatte, der Autarkie zu entkommen und mit einer Welt in Kontakt zu kommen, in der es Kaugummi, Coca-Cola und Jeans gab. Diese westlichen Güter waren Symbole, die die Sehnsucht nach Freiheit signalisierten. Doch es gibt einen Unterschied zwischen dem Wunsch nach mehr Handlungsfreiheit und dem Wunsch nach einer freien Marktwirtschaft; in diesem isolierten kommunistischen Kontext kamen sie zusammen.