Isabel Feichtner ist Juraprofessorin an der Universität Würzburg. Im Interview mit Surplus spricht sie über Bodenpolitik und die Herausforderung, Menschenrechte zu verteidigen und gleichzeitig das Recht zu transformieren.
Frau Feichtner, die meisten Menschen beschäftigen sich nie mit dem Wert von Böden, höchstens, wenn es ums Eigenheim geht. In Ihrem Buch bezeichnen Sie jedoch die Bodenfrage als zentrale Frage unserer Zeit. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?
Böden sind eine Lebensgrundlage, genauso wie Wasser oder Luft. Das sind komplexe Ökosysteme, auch sie sind bedroht und werden stetig zerstört. Böden werden versiegelt, vergiftet, zum Beispiel durch Pestizide, sie werden durch industrielle Landwirtschaft verdichtet und sie erodieren durch Starkregen. So werden Bodenökosysteme unwiederbringlich vernichtet. In Überlegungen zur sozial-ökologischen Transformation werden Böden oft ausgeklammert. Treibhausgasemissionen sollen verringert werden, dazu werden Märkte für Emissionsrechte oder Kompensationszertifikate geschaffen. Diese Märkte werden losgelöst vom Boden gedacht – auf dem aber die Tätigkeiten stattfinden, die Emissionen produzieren. Ich denke, wir müssen Bruno Latours Aufforderung ernst nehmen, terrestrisch zu werden. Das heißt, wir müssen alle Maßnahmen, die wir ergreifen, zurückbinden an die kritische Zone, in der Leben auf dem Planeten möglich ist und damit eben auch an den Boden. Das würde dann bedeuten, Suffizienz und Zirkularität ernst zu nehmen.
Nun sind Sie auch Professorin für Rechtswissenschaft. Wie ist das Thema der Böden im Recht verankert?
In meinem Buch konzentriere ich mich auf Eigentum. Es gibt natürlich viele andere Rechtsgebiete und Rechtsvorschriften, die für den Boden relevant sind, etwa das Baurecht oder das Raumordnungsrecht. Aber ich war vor allem daran interessiert, wie Recht, zusammen mit anderen Techniken und Infrastrukturen, aus Land und Boden Grundstücke macht. Ich untersuche, wie diese Grundstücke dann zu Waren werden, die auf einem Grundstücksmarkt gehandelt werden und wie sie dann noch als Kapitalanlagen fungieren, in die Menschen investieren, um finanzielle Erträge zu erwirtschaften.
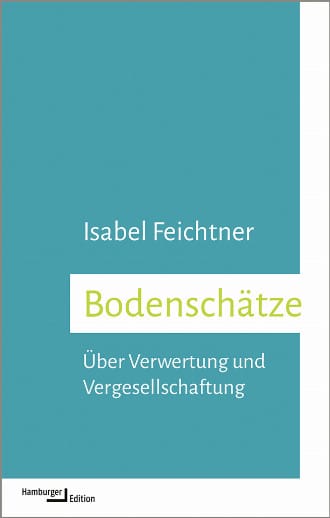
Isabel Feichtner: Bodenschätze
Über Verwertung und Vergesellschaftung. April 2025, Hamburger Edition.
Wie wird Boden zur Ware?
Um aus Boden Grundstücke und Objekt von Eigentumsrechten zu machen, braucht es verschiedene Techniken. Durch Vermessungen und Begrenzungen zum Beispiel werden aus Boden Grundstücke, die als unbewegliche Sachen gelten, an denen Personen Privateigentum haben können. Im Grundbuch werden die Grundstücke, ihre Eigentümerinnen oder Eigentümer und auch Eigentumswechsel eingetragen. Das hilft dabei, Grundstücke »verkehrsfähig« zu machen. Durch Privateigentum in Verbindung mit der Vertragsfreiheit werden die Grundstücke als Sachen zu Waren, die auf einem Bodenmarkt gehandelt werden können. Grundstücke sind aber nicht nur Waren, sondern werden zunehmend auch zu Kapitalanlagen. Manche sprechen hier von »Assetisierung«. Auch dafür ist das Recht, vor allem das Gesellschaftsrecht, mitverantwortlich.
Wie geschieht dieser Übergang von Ware zu Kapitalanlage?
Laut Irving Fisher kann alles Kapital sein, was künftige Erträge generiert. Dieser Definition zufolge ist eine Mietwohnung Kapital, weil sie Mieten einbringt. In diesem Sinne ist Boden schon lange Kapitalanlage. Seit der Jahrtausendwende sind in Deutschland allerdings auch in großem Stil indirekte Investitionen in Grund und Boden möglich geworden. Große öffentliche Wohnungsbestände und auch Werkswohnungsbestände wurden an Fonds und Unternehmen verkauft. Diese verkaufen Geschäftsanteile, Aktien und geben Anleihen aus und ermöglichen so auch indirekte Investitionen in Boden. Jetzt gibt es das Problem, dass diese Unternehmen ihren Anlegern gegenüber verpflichtet sind, Gewinne zu erwirtschaften. Das erhöht den Verwertungsdruck und wirkt sich nachteilig auf die Mieterinnen aus. Denn die Investoren haben ein Interesse daran, dass Mieten steigen und sich so ihre Profite erhöhen.
Zu diesem strukturellen Verwertungsdruck kommt noch die Verwertungsmacht hinzu. Wenn ein Unternehmen mehrere tausend Wohnungen besitzt und sich am Kapitalmarkt finanziert, hat es andere finanzielle, rechtliche und politische Möglichkeiten auf Mietsteigerungen hinzuwirken als andere private Vermieter. Es kann zum Beispiel auf Politik einwirken, damit diese Mietpreisbeschränkungen lockert oder wieder abschafft.
Große Wohnungsunternehmen nutzen also ihre Verwertungsmacht, um Recht in ihrem Sinne durchzusetzen. In ihrem Buch beschreiben Sie, dass Recht auch als Mittel zur Gegenwehr genutzt werden kann. Wie kann das aussehen?
Recht ist eine Infrastruktur, die Macht- und Verwertungsbeziehungen begründet und strukturiert, zum Beispiel zwischen Vermietenden und Mietenden oder Wohnungslosen. Diese Beziehungen gehen mit Ausschlüssen und Verdrängung einher, und auch mit ökologischer Zerstörung. Aber Recht kann auch eine Rolle in der Transformation dieser Macht- und Verwertungsbeziehungen spielen. In meinem Buch skizziere ich drei Strategien für ein Transformationsrecht. Erstmal gilt es, Recht gegen Recht einzusetzen. Dafür haben wir zum Beispiel den Artikel 15 im Grundgesetz, der ein Kollektivrecht begründet, um Privateigentum an Grund und Boden in Gemeineigentum zu überführen. Das ist der Artikel, den die Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen nutzen will, um Macht- und Verwertungsstrukturen im Wohnsektor abzubauen.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login








