Technologie verändert die Welt. Kapital entscheidet, in welche Richtung. Dieser Newsletter zeigt, was das für uns bedeutet. Bleibt dran und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Die drei wichtigsten News der letzten zwei Wochen
1. YouTube hatte nach dem Sturm aufs Kapitol 2021 den Kanal von Donald Trump gesperrt. Dagegen klagte Trump – jetzt gibt es eine außergerichtliche Einigung: YouTube zahlt ihm 25 Millionen US-Dollar.
Wichtig, weil ein milliardenschwerer Konzern lieber zahlt, als sich juristisch gegen Trump durchzusetzen, und damit verdeutlicht, wie stark politischer Druck die Regeln im Netz verschieben kann.
2. In der Schweiz liegt ein Entwurf für die neue Überwachungsverordnung (VÜPF) vor. Sie verpflichtet künftig auch Dienste wie Mail, Messenger, Cloud oder VPN, Nutzerdaten vorzuhalten und Ermittlungsbehörden Zugriff zu geben – selbst ohne konkreten Verdacht.
Wichtig, weil damit eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung auf fast alle digitalen Dienste ausgeweitet würde und die Schweiz ihr bisher starkes Datenschutzmodell aufgibt. Die Folge: Mehr Überwachung, weniger Vertrauen in digitale Dienste – und das Risiko, dass Anbieter den Schweizer Markt verlassen.
3. F-Droid (der alternative App-Store für Android/Open Source) fordert Regulierungsbehörden auf, Googles Pläne zur Einschränkung des »Sideloading« zu stoppen – also das Installieren von Apps außerhalb des offiziellen Play Stores.
Wichtig, weil diese Beschränkungen den Wettbewerb ersticken würden: Nur Apps, die Googles Regeln und Identitätsprüfungen erfüllen, dürften verbreitet werden – viele freie oder unabhängige Apps wären dann faktisch ausgeschlossen.
Thema der Woche:
»Techkonzerne sind heute so mächtig wie ganze Staaten.«
»Techkonzerne sind heute so mächtig wie ganze Staaten.«
Mit neunzehn stand ich im Silicon Valley – ein Stipendium hatte mich in ein Gründer-Bootcamp gebracht, das von dem Milliardär Tim Draper gegründet wurde. Draper war nicht nur Investor bei Firmen wie Tesla oder SpaceX, er inszenierte Unternehmertum wie eine Religion: Gründer oder Gründerinnen waren Helden, Investoren und Investorinnen die Richtenden darüber, wer Erfolg verdient. Die Tage waren streng getaktet, der Druck allgegenwärtig. Schon damals lernte ich, dass es in dieser Welt nicht nur um Geschäftsideen geht, sondern um Strukturen, die von Anfang an festlegen, wer später die Macht hat. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Start-ups nie nur ökonomische Experimente sind – sie sind immer auch politische Projekte. Denn hier wird eingeübt, dass Kapital und Eigentum nicht nur über Märkte entscheiden, sondern auch über Öffentlichkeit und Gesellschaft.
Die Journalistin Carole Cadwalladr prägte den Begriff »Broligarchie«: eine Oligarchie von Tech-Milliardären, die nicht gewählt, sondern erkauft ist. Ihre Macht beruht nicht auf Kapital allein, sondern auf Plattformen und der Fähigkeit, öffentliche Aufmerksamkeit nach eigenen Interessen zu lenken. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen?
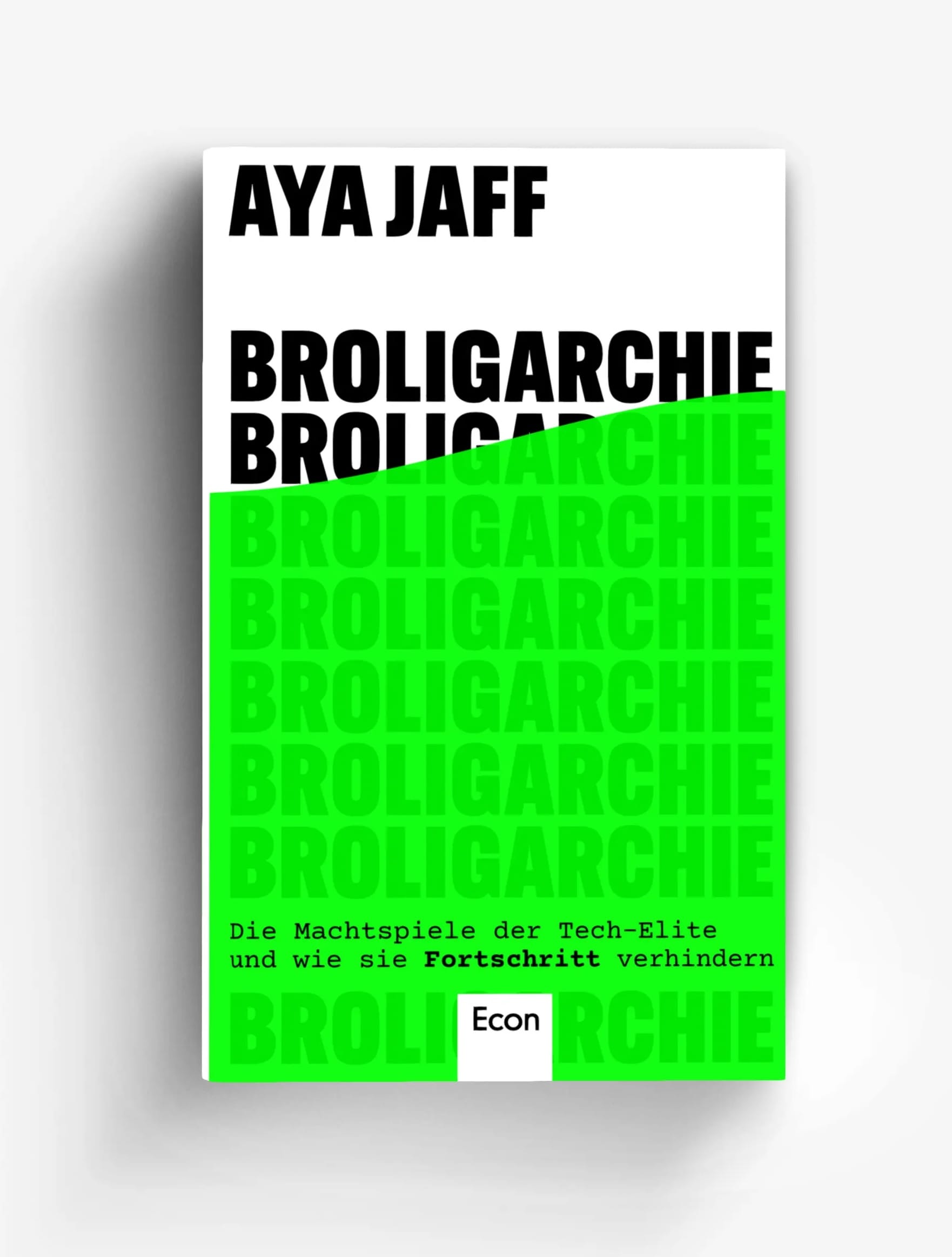
Aya Jaffs Buch: Broligarchie
Die Machtspiele der Techelite und wie sie Fortschritt verhindern. Ullstein Verlag, erscheint im November 2025.
Aktuelle Bilder zeigen, wie weit dieser Einfluss reicht. Beim Dinner im Weißen Haus mit Präsident Trump saßen über dreißig Spitzenvertreter der Tech-Branche an einem Tisch. Sie kündigten Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe in die USA an und überhäuften den Präsidenten mit Lob für seine Wirtschaftspolitik. Apple-Chef Tim Cook sprach von einem »beeindruckenden Fokus auf Innovation«. Diese Inszenierung macht sichtbar: Tech-Eliten stellen sich nicht gegen die Politik, sie umwerben sie – solange sie im Gegenzug Freiheiten und Förderungen erhalten.
War die Tech-Elite schon immer so? Historisch wurzelt ihre Ideologie im Kalifornien der 1960er und 70er Jahre. Damals verband sich der Freiheitsdrang der Gegenkultur mit dem Glauben an Technologie. Der Staat galt als Hemmschuh, Innovation als Befreiung. Diese Denkweise, bekannt als »California Ideology«, glorifizierte Gründerinnen als Rebellinnen gegen alte Strukturen. Heute ist davon vor allem das Misstrauen gegenüber Regulierung geblieben – nicht mehr als jugendliche Rebellion, sondern als Grundpfeiler milliardenschwerer Konzerne. Wer hätte gedacht, dass die selbsternannten Rebellen des Silicon Valley mal so bereitwillig vor einem Präsidenten strammstehen?
Die autoritäre Wende der Techbros
Besonders ernst wird es dort, wo diese Haltung mit rechter Politik verschmilzt. Deregulierung, Anti-Staat-Rhetorik und die Verherrlichung einzelner Eliten passen erstaunlich gut zu konservativen und rechtspopulistischen Narrativen. Tech-Eliten müssen dafür kaum ihre Sprache ändern – wenn sie von »Freiheit« sprechen, meinen sie in Wahrheit Freiheit von Steuern, Freiheit von Arbeitsrechten, Freiheit von demokratischer Kontrolle. Genau diese Parolen greifen rechte Bewegungen auf und übersetzen sie in ihre eigene Agenda. Elon Musk ist dafür das sichtbarste Beispiel: Er nutzt X, um rechte Politikerinnen und Politiker sowie rechte Bewegungen zu unterstützen – sei es durch Reichweite, durch seine öffentlichen Statements oder durch Spenden. So wird die Tech-Bro-Ideologie zu einer politischen Kraft, die autoritäre Tendenzen befeuert.
Das Problem ist aber nicht erst an der Spitze sichtbar. Es beginnt in den Strukturen, in denen Tech-Unternehmen entstehen. Schon beim Börsengang behalten Gründer oder Gründerinnen häufig übergroße Stimmrechte. Wer Anteile kauft, kauft mit, aber die Entscheidungsmacht bleibt bei den Gründerinnen und Gründern. So wird Macht von Anfang an zementiert – und Erfolg bedeutet fast automatisch, dass Gründer und Gründerinnen im übertragenen Sinne zu Königen und Königinnen über ihre Konzerne aufsteigen.
Wir reden von Firmen, die mehr Geld bewegen als ganze Länder – und trotzdem tun wir so, als wären sie normale Unternehmen. Der politische Wille, ihre Macht zu beschneiden, fehlt. Google könnte nach Wettbewerbsrecht längst aufgespalten werden, doch niemand wagt es. Europäische Gesetze existieren, greifen aber selten an den Kern der Machtstrukturen. Stattdessen wächst der Einfluss weiter: Larry Ellison finanziert Plattformkäufe und positioniert sich als Strippenzieher im Hintergrund. Jeff Bezos besitzt mit der Washington Post eine der wichtigsten Stimmen des amerikanischen Journalismus. Mark Zuckerberg steuert mit Meta die sozialen Netzwerke, die unsere politischen Debatten prägen. Und Elon Musk verschiebt mit X die öffentliche Diskussion nach eigenem Gusto. Wer die Kanäle kontrolliert, kontrolliert am Ende auch die Demokratie.
Und wir sehen zu – aus Bequemlichkeit (wenn wir weiterhin über Apple Pay statt per Banküberweisung zahlen), aus Angst (abgehängt zu werden, wenn wir nicht auf den gängigen Plattformen aktiv sind) oder aus fehlendem Mut, als Staat dort Grenzen zu ziehen, wo Kapital längst die Demokratie unterwandert hat. Stattdessen begnügt man sich mit Bußgeldern – Kosten, die Konzerne wie Portokassenbeträge verbuchen. Wenn wir die Macht der Broligarchie brechen wollen, reicht es nicht, über Steuern oder Ethikrichtlinien zu reden. Wir müssen die Eigentumsfrage stellen – auch in der digitalen Welt.
Digitale Infrastruktur ist längst privatisiert, ohne dass es je eine öffentliche Debatte dazu gab. Server, Clouds, Algorithmen – fast alles, worauf unser Alltag basiert, gehört ein paar Konzernen. Damit bestimmen sie die Bedingungen, unter denen Gesellschaft funktioniert. Die Alternative liegt auf der Hand: Wir müssen digitale Infrastruktur als öffentliche Aufgabe begreifen – so selbstverständlich wie Straßen, Wasser oder Stromnetze. Cloud-Dienste, Suchmaschinen oder soziale Netzwerke dürfen nicht in der Hand einzelner Konzerne bleiben. Sie müssen als kollektives Gut organisiert werden, damit demokratische Kontrolle möglich ist. Ebenso wichtig ist Transparenz. Heute sind die Algorithmen, die unsere Aufmerksamkeit lenken, Blackboxes. Niemand weiß, warum bestimmte Inhalte sichtbar werden und andere verschwinden. Solange wir nicht nachvollziehen können, wie diese Systeme arbeiten, bleiben sie politische Waffen in privater Hand. Eine demokratische Gesellschaft braucht das Gegenteil: klare Regeln, öffentliche Kontrolle und die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren. Und schließlich müssen wir die Strukturen ändern, die Gründerinnen und Gründer nahezu unantastbar machen. Wenn ein Unternehmen systemrelevant ist – und viele Tech-Firmen sind es längst –, dann muss demokratische Kontrolle stärker greifen als persönliche Machtansprüche.
Ohne solche Eingriffe werden wir weiter zusehen, wie Tech-Bros ganze Medienhäuser kaufen, Narrative prägen und Wähler und Wählerinnen verschieben. Die entscheidende Frage ist: Wollen wir in Demokratien leben, in denen Parlamente Gesetze machen? Oder in Plattformstaaten, in denen Gründerinnen die Spielregeln bestimmen?
Cliffhanger der Woche
Der Messengerdienst Signal sagt: Wenn die EU die Chatkontrollen einführt, verlässt das Unternehmen Deutschland. Das würde bedeuten, dass eine der letzten wirklich sicheren Apps verschwindet
– entschieden wird darüber schon am 14. Oktober.
Bis zur nächsten Woche,
Aya Jaff







