Mit dem Fortschritt der KI und ihrer zunehmenden Präsenz in unserem Leben ist es unwahrscheinlich, dass sie eine technologische Utopie schafft oder die Menschheit auslöscht. Wahrscheinlicher ist ein Ergebnis, das irgendwo dazwischen liegt: eine Zukunft, die von Zufällen, Kompromissen und vor allem von den Entscheidungen geprägt ist, die wir heute darüber treffen, wie wir die Entwicklung der KI einschränken beziehungsweise lenken wollen.
Als weltweit führende Nation im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) spielen die USA eine besonders wichtige Rolle bei der Gestaltung dieser Zukunft. Doch der kürzlich von US-Präsident Donald Trump angekündigte KI-Aktionsplan hat die Hoffnungen auf eine stärkere Bundesaufsicht zunichte gemacht. Stattdessen wird ein wachstumsorientierter Ansatz für die Entwicklung der Technologie verfolgt. Dies macht es für die Regierungen der Bundesstaaten, Investoren und die amerikanische Öffentlichkeit umso dringlicher, sich auf ein weniger diskutiertes Instrument der Rechenschaftspflicht zu konzentrieren: die Unternehmensführung.
Ethik-Washing in der KI-Branche
Wie die Journalistin Karen Hao in ihrem Buch Empire of AI dokumentiert, betreiben die führenden Unternehmen der Branche bereits Massenüberwachung, beuten ihre Mitarbeiter aus und verschlimmern den Klimawandel. Die Ironie dabei ist, dass viele von ihnen gemeinnützige Unternehmen (Public Benefit Corporations, PBCs) sind, deren Führungsstruktur angeblich darauf ausgelegt ist, solche Missbräuche zu vermeiden und die Menschheit zu schützen. Offensichtlich funktioniert dies nicht wie beabsichtigt.
Die Strukturierung von KI-Unternehmen als PBCs hat sich als äußerst erfolgreiche Form des Ethik-Washings erwiesen. Durch das Signalisieren von Tugendhaftigkeit gegenüber Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit erwecken diese Unternehmen den Anschein von Verantwortlichkeit. Dadurch können sie einer systematischeren Überwachung ihrer nach wie vor undurchsichtigen und potenziell schädlichen täglichen Praktiken entgehen.
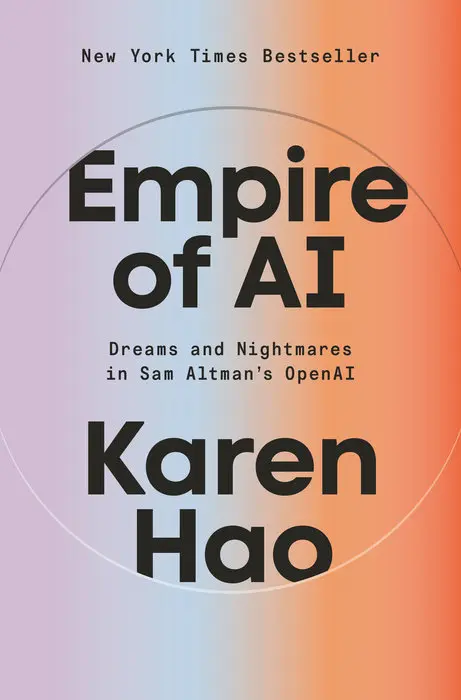
Karen Hao: Empire of AI
Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI. Mai 2025, Pengiun Random House.
Ein Beispiel dafür ist Elon Musks xAI, eine PBC, deren erklärte Mission es ist, »das Universum zu verstehen«. Die Handlungen des Unternehmens – von der heimlichen Errichtung eines umweltverschmutzenden Supercomputers in der Nähe eines überwiegend von Schwarzen bewohnten Stadtteils in Memphis, Tennessee, bis hin zur Entwicklung eines Chatbots, der Hitler lobt – zeugen jedoch von einer beunruhigenden Gleichgültigkeit gegenüber Transparenz, ethischer Kontrolle und den betroffenen Gemeinden.
PBCs sind ein vielversprechendes Instrument, das es Unternehmen ermöglicht, dem Gemeinwohl zu dienen und gleichzeitig Gewinne zu erzielen. In seiner derzeitigen Form weist das Modell jedoch – insbesondere nach dem Recht des Bundesstaates Delaware, in dem die meisten US-amerikanischen Aktiengesellschaften ihren Sitz haben – zahlreiche Lücken und Schwächen bei der Durchsetzung auf. Daher kann es keine Sicherheitsvorkehrungen oder Schutzmechanismen für die Entwicklung von KI bieten. Um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden, die Aufsicht zu verbessern und sicherzustellen, dass Unternehmen das öffentliche Interesse in ihre Geschäftsgrundsätze einbeziehen, müssen staatliche Gesetzgeber, Investoren und die Öffentlichkeit eine Neugestaltung und Stärkung von PBCs fordern.







