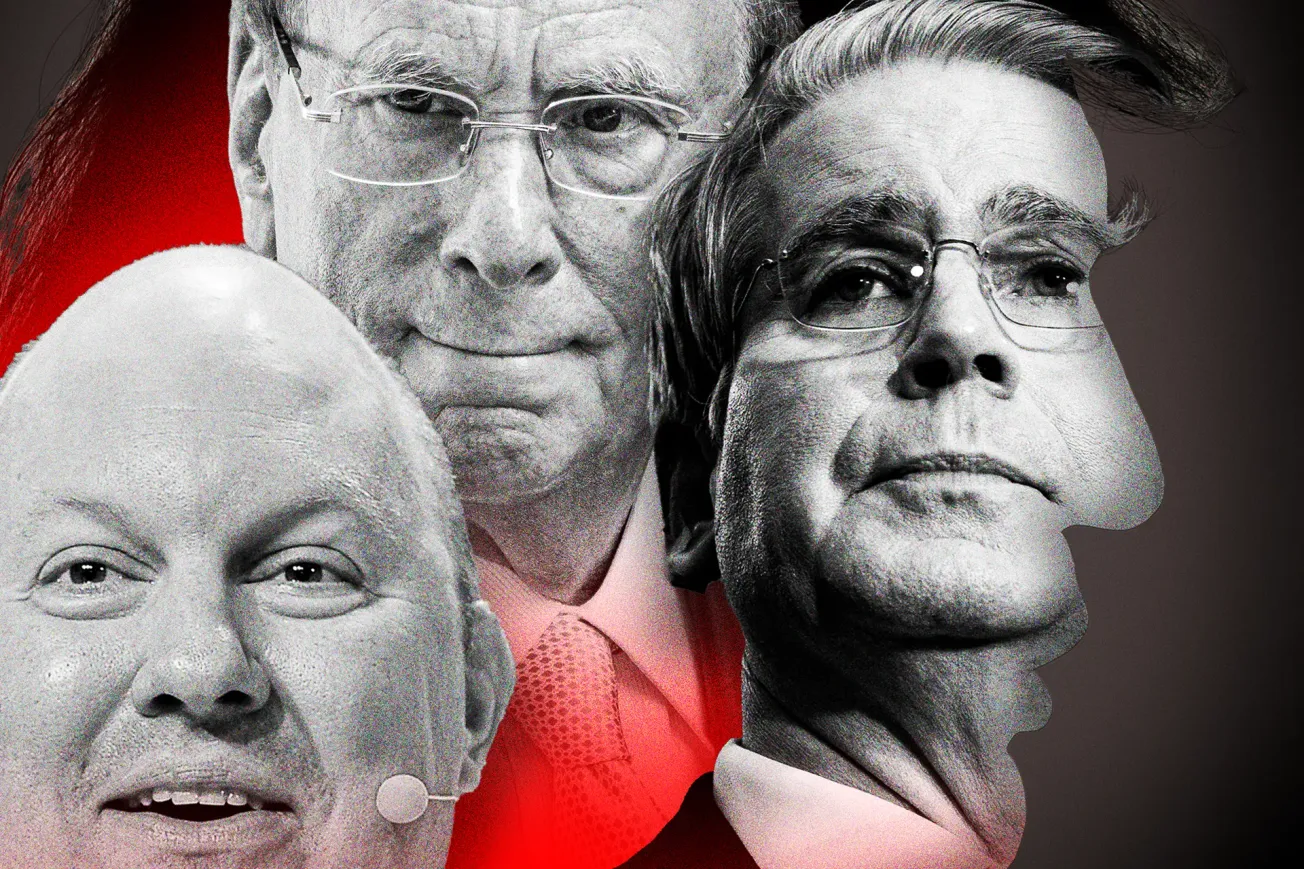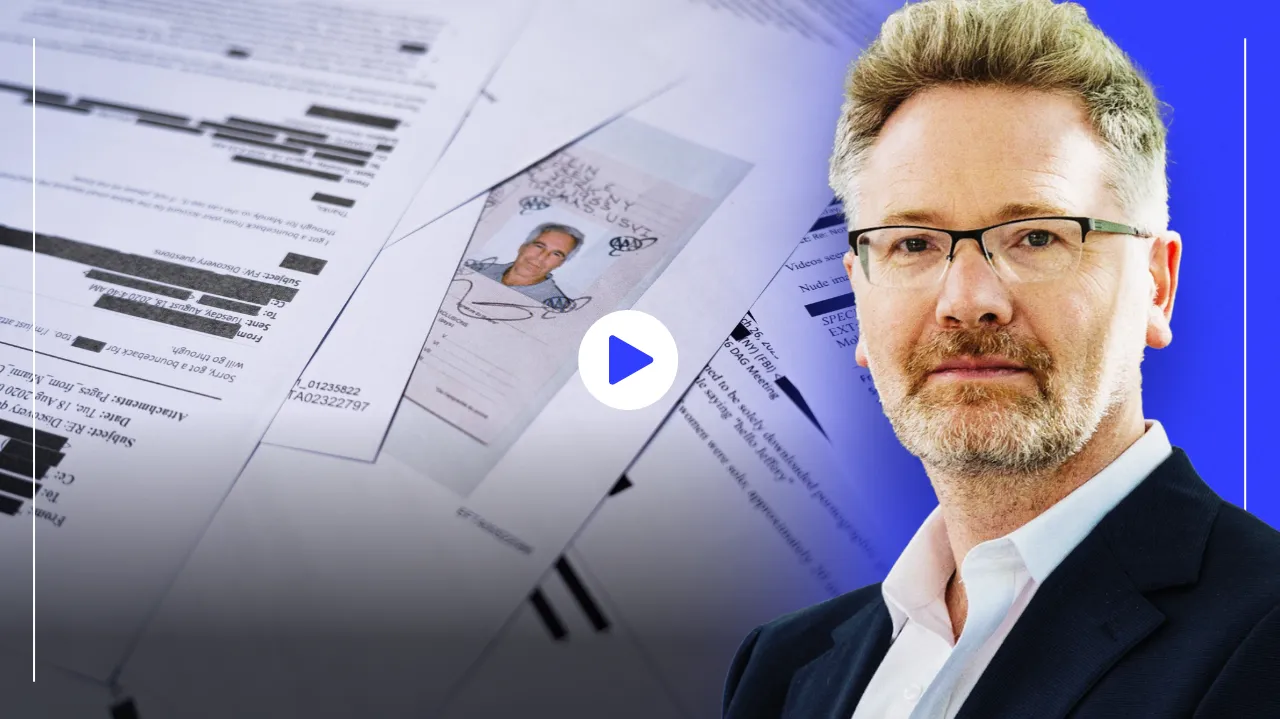Der Niedergang einer hegemonialen Macht ging – wenn man dem Historiker Fernand Braudel folgt – meist mit Finanzialisierung einher. Angesichts sinkender Rentabilität in Produktion und Handel verlagern die Kapitaleigner ihr Vermögen in die Finanzwirtschaft. Das ist laut Braudel ein Anzeichen für einen einsetzenden »Herbst«, in dem sich Imperien »in eine Gesellschaft von Rentier-Investoren verwandeln, die auf der Suche nach allem sind, was ihnen ein ruhiges und privilegiertes Leben garantiert«.
Dieses Gespenst des braudelschen Niedergangs sucht auch wichtige Figuren der zweiten Trump-Administration heim. »Sagt mir, was alle ehemaligen Reservewährungen gemeinsam haben«, sinnierte Scott Bessent, inzwischen Finanzminister, während des Wahlkampfs. »Portugal, Spanien, Holland, Frankreich, Großbritannien [...] – wie haben sie ihren Status als Leitwährung verloren?« Seine Antwort: »Sie haben sich hoch verschuldet und konnten ihr Militär nicht mehr unterhalten.« Bessent, ein ehemaliger Hedgefondsmanager, betont zwar offiziell, es gebe kein Programm zur Dollarabwertung. Tatsächlich aber wurde der Dollar-Wechselkurs seit Trumps Amtsantritt im Januar von Spekulanten nach unten getrieben. Auch Außenminister Marco Rubio wetterte in der Vergangenheit gegen die Finanzialisierung. Er ist Autor eines 2019 erschienenen Berichts über »Amerikanische Investitionen im 21. Jahrhundert«. Darin kritisiert er die Wall Street für ihr Shareholder-Value-System, das »Unternehmensentscheidungen darauf ausrichtet, Geld schnell und vorhersehbar an Investoren zurückzuzahlen, anstatt langfristige Unternehmenskompetenzen aufzubauen«. Seine Ansichten werden von selbsternannten republikanischen »Populisten« wie Josh Hawley geteilt.
Diese Feindseligkeit gegenüber der Wall Street sorgte in den ersten Monaten von Trumps zweiter Amtszeit für einen ideologischen Bruch: So erzeugten die Zölle des Präsidenten an seinem »Liberation Day« Aufregung an den Finanzmärkten; die Wall Street antwortete mit Panik, um das Weiße Haus in die Schranken zu weisen. Ob die Allianz aus selbsternannten MAGA-Populisten und Trumps breiterer Wählerbasis nachhaltig bestehen kann, bleibt eine zentrale Frage der zweiten Trump-Regierung. Diese Basis verspricht sich von einer zollbedingten Wiederbelebung der US-Industrie und einem abschiebungsbedingten Rückgang des Arbeitsangebots einen steigenden Lebensstandard und sichere Arbeitsplätze. Die Bruchlinien sind klar: Öl- und Gaskonzerne sowie Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnologie wie Palantir und Anduril finden Gefallen am militarisierten Nativismus der aktuellen US-Führung. Auf der anderen Seite schadet Trumps Handelspolitik dem Finanzsektor und den meisten großen Technologieunternehmen. Dies sind zwei Branchen, die Trump im Wahlkampf konsequent unterstützt haben und nun ihre Belohnung erwarten. Mit einem Angriff auf diese Wirtschaftssektoren riskiert Trump, genau die Fraktionen des US-Kapitals zu verprellen, die ihn zurück ins Amt gehievt haben.
Für einige Kapitalfraktionen ist der Niedergang der USA relativ und könnte – Beispiel Japan – auf eine würdevolle Art bewältigt werden. Wie Giovanni Arrighi 1994 feststellte, hat das Finanzwesen schon immer den Wechsel des Hegemons begleitet – und davon profitiert. Heute schlagen die großen Vermögensverwalter sowohl Profit aus der Umschichtung der US-Portfolios – weg vom absteigenden Hegemon – als auch daraus, dass sie Investoren aus China und anderen aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften Zugang zu US-Vermögenswerten anbieten. Big Tech hingegen strebt eine umfassende Kontrolle über Wissen und wirtschaftliche Koordination an. Das heißt auch: Die Branche hat viel zu verlieren, wenn eine geoökonomische Fragmentierung sie vom weiteren Zugang zu Daten abschneidet, Netzwerkeffekte verringert, die Kosten ihrer materiellen Infrastruktur in die Höhe treibt und bündnisfreie Staaten oder Regionen dazu bringt, die eigene digitale Souveränität anzustreben.
In ihrem Bemühen, das amerikanische Imperium »wiederzubeleben«, muss die Trump-Administration daher einen schwierigen Balanceakt vollziehen. Auf der einen Seite stehen die Wünsche der auf die heimische Industrie fokussierten Nativisten und auf der anderen die der Kapitalfraktionen, deren Interessen sich über den gesamten Globus erstrecken. Zwischen diesen konkurrierenden Interessen zu navigieren, stellt eine enorme Herausforderung dar, die möglicherweise über die Überlebensdauer der Trump-Koalition entscheiden wird – und über die Stabilität des globalen Finanzsystems.

»Private Finance« steht hinter Trump
Schon die Wahl 2016 zeigte eine dramatische Spaltung an der Wall Street: Die klassischen »Too-big-to-fail«-Banken und Verwalter öffentlicher Vermögen stellten sich zumindest rhetorisch hinter die Demokraten. »Private Finance« oder sogenannte alternative Vermögensverwalter – Private Equity, Wagniskapital und Hedgefonds – erwiesen sich hingegen als Unterstützer von Trumps erster Präsidentschaftskandidatur. Diese Spaltung konnte man zuvor bereits im Vereinigten Königreich beobachten, wo eine lautstarke Gruppe von Private-Equity- und Hedgefonds-Mogulen ihre Zustimmung zum Brexit bekundete, während sich die traditionelle Finanzwelt für einen Verbleib in der EU aussprach.