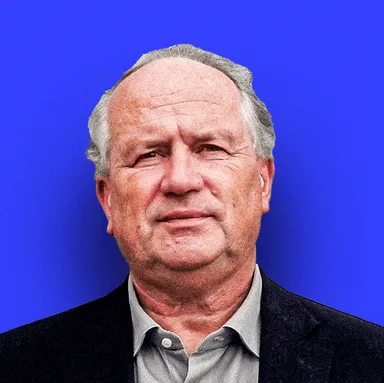Xenia Miller: Frau Mayer-Ahuja, würden Sie eine sofortige bundesweite Einführung einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich befürworten?
Mayer-Ahuja: Ich bin für eine »kurze Vollzeit« für alle. Und dafür bin ich auch unter aktuellen Bedingungen. Wir haben in Deutschland eine massive Polarisierung von Arbeitszeiten: Auf der einen Seite arbeitet ein Teil der Beschäftigten deutlich länger, als sie eigentlich möchten, auch deutlich länger, als in ihren Verträgen steht. Und auf der anderen Seite gibt es einen Teil der Beschäftigten, die deutlich kürzer arbeiten, als sie wollen; das sind vor allem Frauen in Teilzeit und »Minijobs«. Sie haben erstens kein existenzsicherndes Einkommen und zweitens auch keine existenzsichernde Alterssicherung. Die Forderung nach »kurzer Vollzeit« würde sehr unterschiedliche Beschäftigtengruppen zusammenbringen: den exzessiv arbeitenden Programmierer und die »Minijobberin« an der Supermarktkasse.
Herr Flassbeck, Sie haben gegenüber einer Arbeitszeitverkürzung Zweifel geäußert?
Flassbeck: Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Standard einer Vier-Tage-Woche. Es ist allerdings nicht nur die Frage eines Wunsches, sondern auch die Frage, wie man das macht. Denn »die Gesellschaft« entscheidet sich leider nicht dafür; viele Leute wollen lieber mehr Geld verdienen. Es kommt auf das an, was wir mit »bei vollem Lohnausgleich« meinen: Den gibt es leider nicht auf dieser Welt. Das behaupten die Gewerkschaften zwar immer, aber in Wirklichkeit muss man sich entscheiden: Will ich Lohn haben oder will ich weniger arbeiten? Arbeitszeitverkürzung heißt Verzicht auf Lohn, und wenn die Produktivität zunimmt und die Löhne abnehmen, dann gibt es Arbeitslosigkeit, dann ist Arbeitszeitverkürzung sogar ein Weg in die Arbeitslosigkeit. Und das will ja auch niemand. Diese beiden Hürden muss man umschiffen, und die sind schon gewaltig. Wünschen kann man sich viel. Aber es ist nicht so einfach.
Mayer-Ahuja: Dass es einfach ist, erwarte ich auch nicht, Herr Flassbeck. Da reden wir über knallharte Verteilungskämpfe, Interessenkonflikte. Selbstverständlich kann man Produktivitätszuwächse nur einmal verteilen, aber die Frage ist, wie. Durch Lohnausgleich könnte man eine Umverteilungswirkung bewirken, die überfällig ist, nachdem in den letzten Jahren vor allem Umverteilung von unten nach oben stattgefunden hat. Der andere Punkt ist aber, dass eben nicht alle Unternehmen gegen Arbeitszeitverkürzung sind. Die Diskussion über die Vier-Tage-Woche wird ja interessanterweise gerade nicht mit Arbeitslosigkeit begründet, sondern mit Fachkräftemangel. Es gibt viele Unternehmen, die sagen: Wir bekommen nicht genug Leute, wir müssen eine Vier-Tage-Woche anbieten. Die Forderung von Friedrich Merz, wir sollten jetzt mehr und effektiver arbeiten, funktioniert nicht. Man kann entweder auf sehr lange Arbeitszeiten setzen (»Modell Frühindustrialisierung«) oder auf sehr intensive Arbeitskraftnutzung (»Modell Deutschland«). Beides zusammen geht nur für eine bestimmte Zeit, danach ist die Arbeitskraft aufgebraucht, der Fachkräftemangel wird größer. Da müsste man doch mal neue Wege gehen, finden Sie nicht?
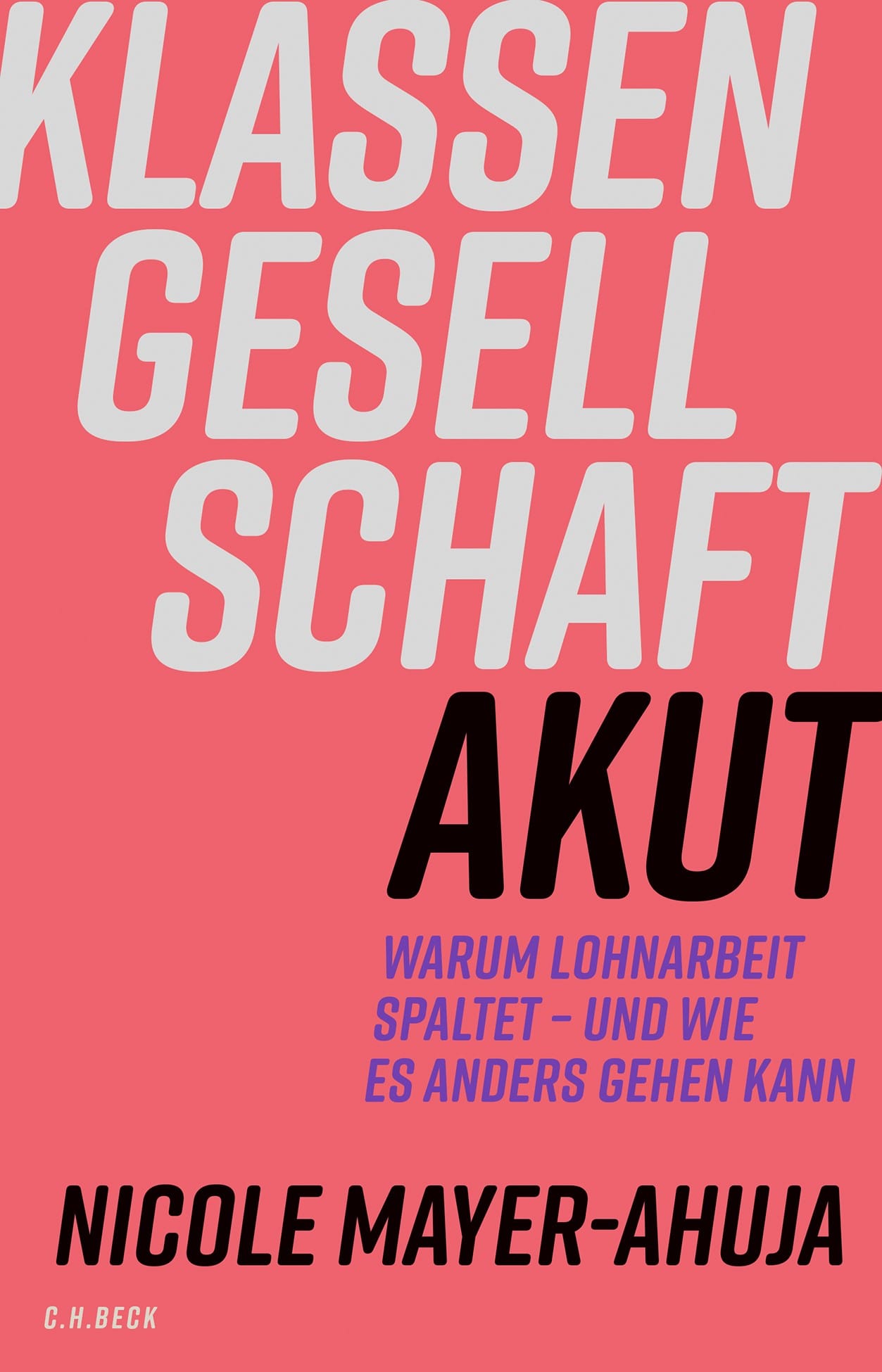
Nicole Mayer-Ahuja: Klassengesellschaft akut
Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann. Erscheint am 18. September 2025, C.H. Beck.
Flassbeck: Wir bekommen keine Umverteilung hin, weil wir immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Fachkräftemangel ist nur ein kleinräumiges Problem in einigen Bereichen. Wir haben immer noch 6 Prozent Arbeitslosigkeit und es kann keine Rede davon sein, dass die Macht der Arbeitnehmer zugenommen hat. Bei ThyssenKrupp werden gerade die Löhne gesenkt, bei VW haben sie die Löhne gesenkt. Wir erleben Lohnsenkungen und das ist vollkommen falsch. Wie Merz von einer Arbeitszeitverlängerung zu reden, ist natürlich Unsinn in einer Zeit, in der wir eine steigende Arbeitslosigkeit haben und eine sinkende Zahl der offenen Stellen. Merz weiß einfach nicht, wovon er redet. Ich bin davon überzeugt, dass die Unternehmen eine kürzere Vollzeitarbeit stemmen könnten. Aber es gibt eben das schreckliche Vorurteil, und das hat Herr Merz wieder bestätigt, dass länger arbeiten besser sei als kürzer arbeiten, weil man unterstellt, dass dabei die Löhne sinken – und das finden insgeheim alle gut. Aber jemand, der intensiv 32 Stunden arbeitet, hat wahrscheinlich bessere Ideen als jemand, der 48 Stunden kloppt. Doch die Hindernisse in der Gesellschaft sind ungeheuerlich. Man müsste erst einmal den Gewerkschaftsmitgliedern ehrlich sagen, dass sie auf Lohnerhöhungen verzichten müssen, statt sie mit dem Unsinn vom »vollem Lohnausgleich« zu verwirren. Man verzichtet auf Lohnerhöhungen, die sonst möglich gewesen wären. Und den Arbeitgebern muss man auch klar sagen, dass Arbeitszeitverlängerung nichts mit Lohnsenkung zu tun hat. Dann kommen die auch nicht auf so dumme Ideen wie das Streichen von Feiertagen.
Sehen Sie eine Strategie, wie man diesen Verteilungskampf wieder zugunsten der Arbeitnehmenden, zum Beispiel für eine »kurze Vollzeit«, gewinnen könnte?
Mayer-Ahuja: Wir sind uns völlig einig, was die defensive Position der Gewerkschaften angeht. Die Frage ist, wie wir wieder in die Offensive kommen. Neben Beschäftigungssicherung war es ja gerade die Forderung nach Humanisierung des Arbeitslebens und Emanzipation, die in den 80er Jahren die Leute überzeugt hat, für die 35-Stunden-Woche auf die Straße zu gehen. Wer redet heute noch über »mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen«? Im Gegenteil: Die Schraube ist inzwischen derartig angedreht worden in sehr vielen Unternehmen, dass Beschäftigte in Arbeitszeitumfragen eine kürzere Arbeitszeit befürworten, viele sogar mit Lohnverzicht. Gerade in der Pflege ist es ein Riesenproblem, dass gut qualifizierte Beschäftigte »freiwillig« Stunden reduzieren oder ganz aus dem Beruf ausscheiden, weil sie den Druck nicht mehr aushalten. Das heißt: individuelle Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich als Mittel der Selbstverteidigung. Nicht nur die Wirtschaft kriselt, sondern auch der Reproduktionsbereich. Diese langen, sehr verdichteten Arbeitszeiten haben zur Folge, dass sehr viele Beschäftigte sich nicht mehr ausreichend erholen können, dass sie permanent am Limit arbeiten, dass sie krank werden. Wenn alle immer länger arbeiten sollen, wer kümmert sich dann noch um Kinder und alte Menschen? Was machen wir, wenn das ganze Leben voll auf Erwerbsarbeit und »immer schneller, höher, weiter« gepolt ist? Mit dieser Zuspitzung haben die Gewerkschaften einen anderen Hebel. In einer Situation, in der derartig viel Druck im Kessel ist, liegt doch die Frage nahe, mit welchen neuen Forderungen man in diese Auseinandersetzungen reingeht und ob es möglich ist, Denkverbote zu überwinden. »Es gibt keine Alternativen«, wird uns seit Margaret Thatcher eingebläut. Wer hindert uns daran, über andere Standards des gesellschaftlichen Zusammenlebens nachzudenken?
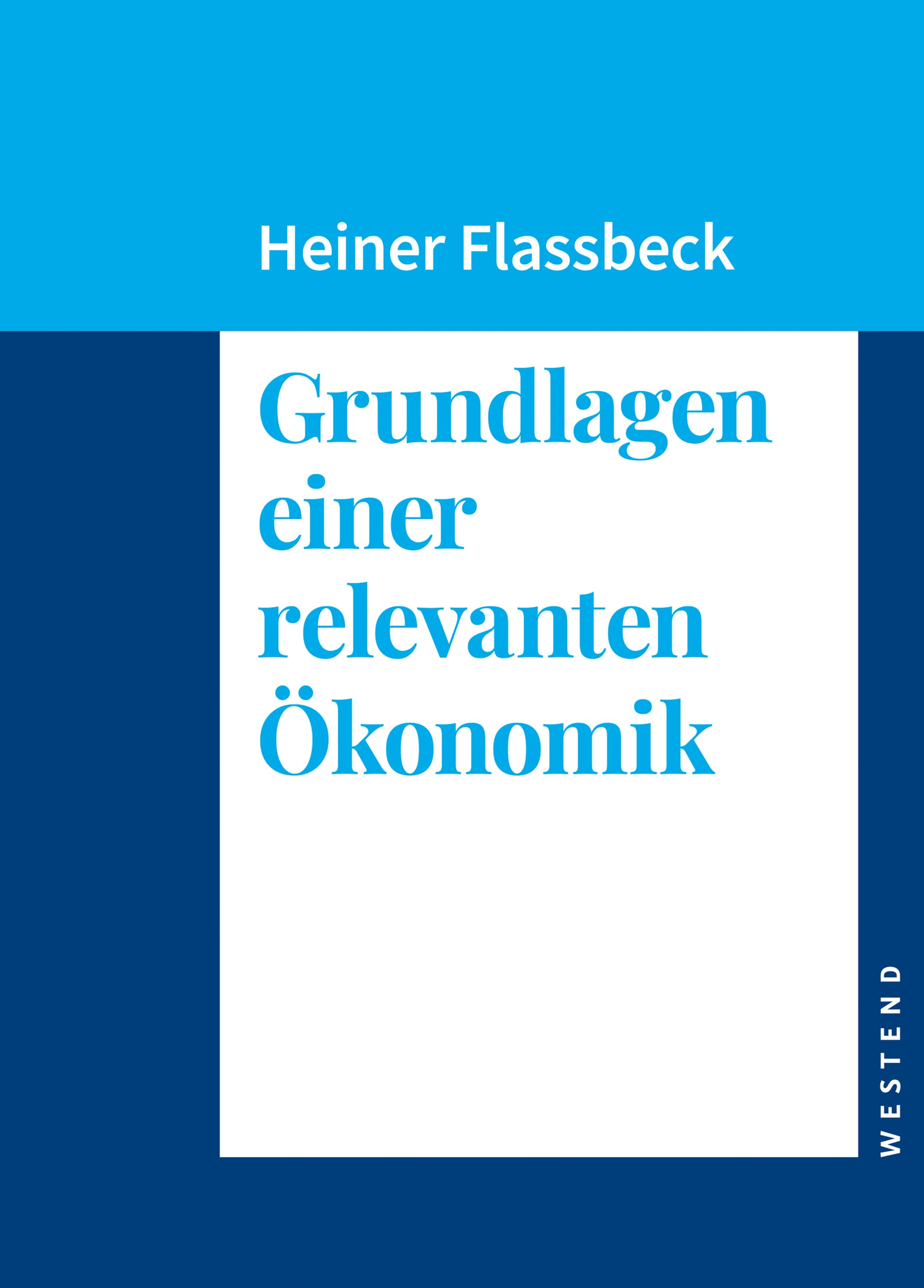
Heiner Flassbeck: Grundlagen einer relevanten Ökonomik
Unter Mitarbeit von Friederike Spiecker, Patrick Kaczmarczyk und Alexander Mosca Spatz. 1. September 2024, Westend Verlag.
Flassbeck: Da stimme ich weitgehend zu, doch es bleibt eine Macht- und eine Erkenntnisfrage. Die Gewerkschaften sind seit Jahrzehnten in einer schwachen Position. Anfang der 2000er Jahre haben sich die Gewerkschaften von einer rot-grünen Regierung massiv in die Defensive drängen lassen und die Hartz-IV-Gesetzgebung akzeptiert, sodass der Druck auf die Menschen, Arbeitslosigkeit auf jeden Fall zu vermeiden, ganz ungeheuer groß wurde. Man muss heute sehr viel mehr Angst vor Arbeitslosigkeit haben als zuvor. Mit der Arbeitslosigkeit ist den Menschen in die Hirne gepflanzt worden, dass alles, was man sich gönnt, alles, was man sich leistet – ob kürzere Arbeitszeit, höhere Löhne oder mehr Sozialhilfe –, Arbeitsplätze kostet. Das ist grandioser Unsinn. Wir müssen zunächst wieder zurückkommen zu einer vernünftigen Arbeitslosenversicherung. Nach einem Jahr schon bist du heute im Bürgergeld und eine arme Sau. Man braucht eine vernünftige Absicherung, wie das früher einmal war. Das wäre der erste Schritt. Und der einzige Weg, die Gewerkschaften zu stärken, ist Vollbeschäftigung. Wir brauchen eine Vollbeschäftigungspolitik, sodass sich die Machtverhältnisse verschieben. Aber davon ist in Europa leider nicht die Rede.
Das eine ist eine Arbeitszeitverkürzung, die von Gewerkschaften erkämpft wird. Die gesetzliche Perspektive ist eine andere. Spanien hat kürzlich erst ein Gesetz verabschiedet, das eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 2,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich vorsieht. Wenn man das ein paar Jahre wiederholt, hat man die Vier-Tage-Woche. Wie würde das wirtschaftlich wirken, Herr Flassbeck?