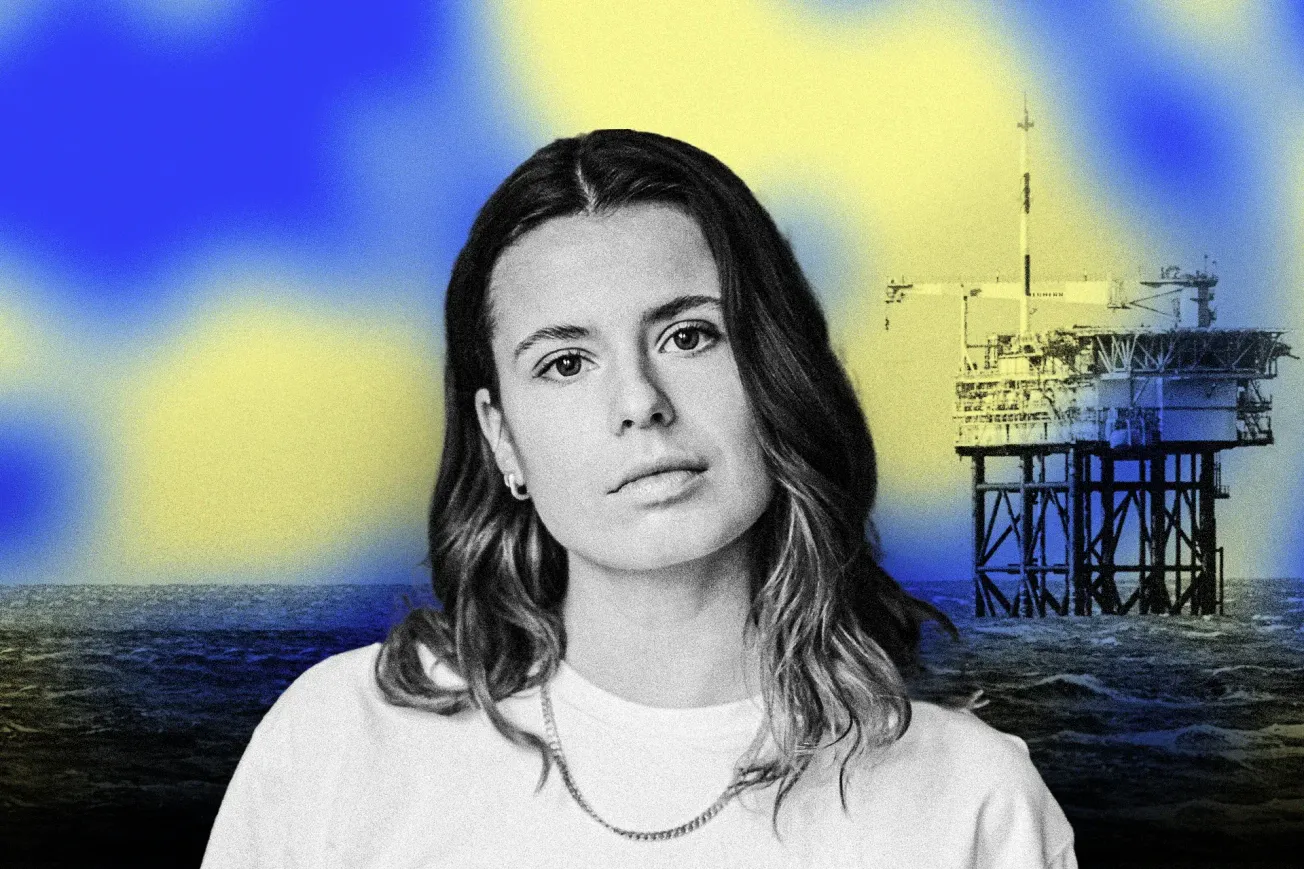Über 100 Jahre lang hat man in Deutschland Industrie und Infrastruktur auf »fossil« kalibriert – mit Volldampf. Kohleunternehmen hat man endlose Rechte eingeräumt, sodass sie bis heute mehr als 300 Dörfer und Gemeinden wegbaggern konnten. Man hat sich Steuerregeln ausgedacht, die einzig die Funktion hatten, etwa durch die Pendlerpauschale oder die Nichtbesteuerung von Kerosin das Autofahren und Fliegen künstlich zu verbilligen. Innenstädte wurden planiert, um Schneisen für Autobahnen zu schaffen, die öffentliche Ordnung angepasst, sodass das Parken überall möglich wurde.
Bis heute darf nichts und niemand so problemlos und so weiträumig den öffentlichen Raum besetzen wie parkende Autos. Über endlose Jahrzehnte wurden Millionen Ölheizungen in Millionen Häusern eingebaut, Kilometer an Gasnetzen verlegt, alles unter dem Credo: Wohlstand, Wachstum, Fortschritt. Selbst die verseuchten Flüsse, die verpestete Luft und der saure Regen ließen sich durch die große Geschichte einer schönen neuen Welt rechtfertigen. Das fossile Zeitalter bestand nie nur aus Maschinen und Erfindungen. Entscheidender Teil waren immer auch die großen Erzählungen, die rund um die fossile Expansion zirkulierten. Das eigene Auto war nie nur ein Auto, sondern ein »staatliches Glücksversprechen«. Der Kohlebagger wurde zum Synonym für Wirtschaftswachstum, der Ausbau der Autobahnen zum Freiheitsversprechen.
Und heute? Heute stehen wir vor der Wahnsinnsaufgabe, all das innerhalb weniger Jahrzehnte auf »fossil-frei« umzukrempeln. Diesmal nicht, weil man eine leuchtende Zukunft bauen will, sondern weil man sich eine lebenswerte Zukunft dank der Klimakrise eben kaum mehr vorstellen kann. Doch während Politik und Wirtschaft bei der Durchsetzung fossiler Brennstoffe im letzten Jahrhundert weitgehend euphorisch am Start waren, sind sie bei der aktuellen Dekarbonisierung alles andere als eine konstante Kraft. Im Zweifel stehen sie diesem Jahrhundert-Umbau sogar im Weg.
Erfolge der Transformation
Umso erstaunlicher sind die aktuellen Zahlen. Im Jahr 2025 wird über 50 Prozent des deutschen Stroms durch Erneuerbare produziert. Jeder siebte Haushalt hat mittlerweile eine eigene PV-Anlage, und nebenbei produzieren wir mehr Windenergie als jedes andere EU-Land. Bemerkenswert ist all das vor allem, da das Potenzial von Sonnen- und Windenergie in der Vergangenheit eklatant unterschätzt wurde. So ging man fest davon aus, dass Erneuerbare nie mehr als 15 Prozent unseres Stroms liefern könnten, Solar wurde bis in die Nullerjahre von Bundesministerien als teure »Nischenenergie« verhandelt, erst die rasante Preisentwicklung änderte das. In den 90ern prognostizierten Studien, dass Windenergie im Jahr 2020 maximal 3 bis 5 Gigawatt Strom liefern könnte. Real waren es 60 Gigawatt, heute sind es 65 Gigawatt an Land – plus etwa 10 Gigawatt auf dem Meer.
Die deutschen Klimaziele sind zu schwach, um einen gerechten Beitrag zur Erreichung des Pariser Abkommens leisten zu können. Und in Sachen Verkehrs- und Gebäudewende stellt der Klima-Expertenrat jedes Jahr aufs Neue gravierenden Nachholbedarf fest. Dass 2024 die Klimaziele dennoch erreicht wurden, ist dem unwahrscheinlich schnellen Ausbau der Erneuerbaren zu verdanken.