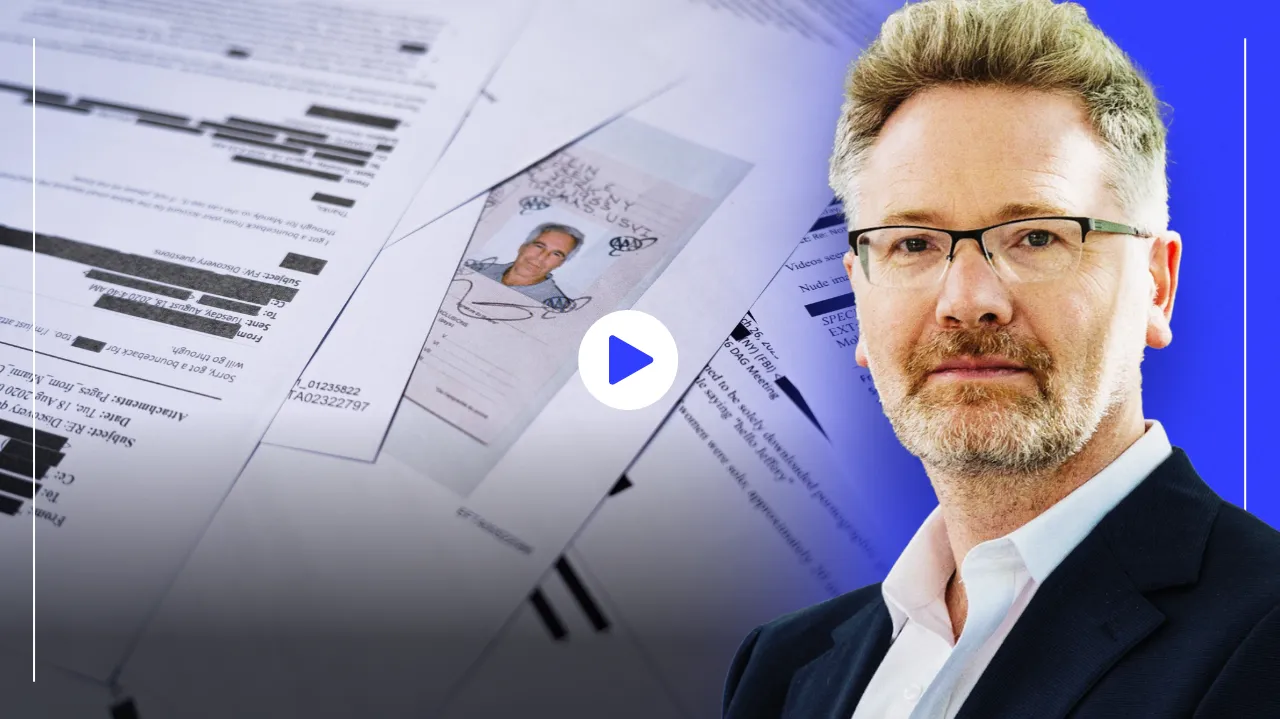Douglas Rushkoff ist Professor für Medientheorie und digitale Wirtschaft am Queens College der City University New York. Er gilt als einer der Vordenker, aber auch schärfsten Kritiker digitaler Entwicklungen. Er verfasste zahlreiche Bücher und prägte die Begriffe »viral gehen« sowie »Digital Natives«. Im Interview spricht er über sein neues Buch Survival of the Richest und erklärt, warum viele US-amerikanischen Tech-Milliardäre einer gefährlichen Ideologie anhängen.
Surplus Magazin: Herr Rushkoff, vor einiger Zeit wurden Sie von Technologie-Milliardären eingeladen, die Ihren Rat hören wollten. Diese Milliardäre planen, sich autonome Enklaven zu errichten, um den drohenden Kollaps der Gesellschaft zu überleben. Was haben Sie ihnen geraten?
Douglas Rushkoff: Ich habe ihnen gesagt, dass ihre Fantasie, der Realität zu entkommen, nicht funktionieren wird. Man kann sich nicht vom Rest der Menschheit isolieren. Doch das haben Sie nicht verstanden. Ich habe Sie gefragt, wie sie die Wachen für ihre Bunker bezahlen wollen, wenn ihr Geld am Ende wertlos sein sollte. Es war interessant, die Reaktionen zu sehen: »Oh, daran habe ich nicht gedacht.« In dem Gespräch wurde deutlich, dass ihr Verständnis der Situation ziemlich kindlich ist. Sie glauben, dass Regierung und Menschen auf diesem Planeten nur existieren, um den Sprung ins Transhumane oder in eine Art neues »Ich« zu befeuern. Einige Tech-Leute sehen sich selbst schon als eine höhere Spezies, während wir anderen nur »normale« Menschen sind.
Warum konzentrieren sich diese Tech-Milliardäre so sehr auf ihr eigenes Überleben, anstatt sich um systemische Probleme wie Armut oder die Klimakrise zu kümmern?
Merkwürdigerweise fühlen sie sich machtlos, obwohl sie zu den mächtigsten Menschen gehören, die ich je getroffen habe. Sie haben extrem viel Geld und Einfluss. Trotzdem haben sie das Gefühl, überhaupt keine Kontrolle zu haben. Statt konstruktive Lösungen zu suchen, verwenden sie ihre Ressourcen darauf, die Zukunft vorherzusagen und sich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch vorzubereiten. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie sie als Investoren an Wissenschaft und Technologie herangehen. In den frühen Cyber-Tagen gab es diese »Hippie-Herangehensweise«, die ich sehr genossen habe. Es ging darum, die Vielfalt menschlicher Möglichkeiten zu erweitern und Raum für vernetzte Kreativität zu schaffen. Sobald aber große Geldsummen im Spiel sind, will man keine neuen Möglichkeiten mehr, sondern Vorhersehbarkeit. Also kehrten sie die ursprüngliche Idee um: Statt Technologie an Menschen zu geben, damit diese Neues erschaffen können, setzen sie Technologie nun gegen die Menschen ein, um deren Verhalten vorhersehbarer zu machen.
Sie sprechen in Ihrem Buch von einer bestimmten Ideologie, die Sie das »Mindset« nennen. Können Sie das genauer erklären?
Das Mindset beschreibt den Glauben, man könne genug Geld ansammeln oder Technologien entwickeln, um der von einem selbst geschaffenen Realität zu entkommen. Es geht darum, dem eigenen Einflussbereich zu entfliehen, indem man etwa den Mars besiedelt, technologische Enklaven baut oder seinen Geist uploadet. Früher bestand bei solchen Ideen der Machthabenden nicht die Gefahr, den ganzen Planeten zu zerstören – Caligula oder Dschingis Khan konnten Zivilisationen vernichten, aber nicht die gesamte Erde aus dem Gleichgewicht bringen. Heute ist das anders.

Was passiert im Mindset-Denken mit den armen Menschen?
Das kann sehr düster werden. Ein zynisches Beispiel? Ein Mensch in einer Krisenregion würde dem Mindset zufolge dem globalen Markt mehr Wert bringen, wenn er Ziel einer teuren Waffe wird, als wenn er ein Produkt herstellt. Wenn man soziopathisch denkt, sieht man eventuell genau darin die Funktion dieses Menschen. Letztlich dienen wir und unser Planet in der Ideologie des Mindset als Brennstoff für die angestrebte Transzendenz einiger weniger Superreicher. Wenn jemand wie Peter Thiel transhumanistische Ideen mit katholischer Theologie verbindet, kann er sich ausmalen, dass Jesus »aufgestiegen« ist und wir es ihm gleichtun könnten. Wer sich dieser angeblich höheren Bestimmung verweigert, gilt dann fast als »satanisch«.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch über Studien, die zeigen, dass Menschen an der Macht oft ein wenig soziopathisch werden. Erklärt sich so das Verhalten der Tech-Elite?
Ich denke nicht, dass sie so geboren werden. Es ist eine Folge davon, dass man sich unempfindlich machen muss, wenn man Milliarden verdient: Man kann nicht so viel Geld anhäufen, ohne das Leben vieler Menschen zu beeinflussen, oft negativ. Selbst wir als Mittelschicht stumpfen schon in dieser Weise ab, denn für unsere Smartphones werden von versklavten Kindern zum Beispiel im Kongo Seltene Erden abgebaut. Wer jedoch Milliarden anhäuft, muss sich noch viel stärker gegen die Folgen seines Handelns abschirmen. Es gibt Studien, die zeigen, dass das Bild eines verhungernden Babys bei einem Tech-Milliardär nicht dieselbe empathische Spiegelreaktion auslöst wie bei anderen Menschen. Offenbar gibt es da ein Problem in bestimmten Frontalhirnarealen, das die Empathiefähigkeit reduziert.
Gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied zwischen den Milliardären vor ein paar Jahrzehnten und den heutigen Tech-Milliardären?
Wenn wir das Handeln der »alten« Tech-Milliardäre wie Bill Gates betrachten, sehen wir meistens neoliberale Politik. Das war zur Zeit von Clinton der einfachste Weg, um global viel Geld zu verdienen. Außerdem bewegten sie sich in großen Netzwerken und mussten sich politisch korrekt geben, ein wenig feministisch auftreten und so weiter. Bei den heutigen Milliardären erleben wir etwas anderes. Mark Zuckerberg zum Beispiel hat zuerst in der neoliberalen Wachstumsblase von San Francisco angefangen und vermittelte uns das Gefühl, irgendwie die Welt retten zu wollen. Dann wechselte er in eine transhumanistische Richtung: Er bekannte sich zum effektiven Altruismus, begann das Metaverse zu schaffen und über eine posthumane Zukunft nachzudenken. Dahinter steckt häufig eine gewisse Rücksichtslosigkeit und eine regelrechte Verachtung für die realen Menschen.
Eine Geschäftsstrategie, die das Denken der Techmilliardäre prägt, beschreiben Sie im Buch als »Meta gehen«. Was bedeutet das?
Kapitalismus und das Digitale funktionieren beide nach dem Prinzip des »Going Meta«. In der Finanzwelt geht es darum, möglichst viele Schritte von der tatsächlichen Arbeit entfernt zu sein und Geld aus Geld zu machen. In der digitalen Welt stapeln wir Symbolsysteme auf Symbolsysteme: Von Web 1.0, wo man mit anderen Einzelhändlern konkurriert, hin zu Web 2.0, wo Plattformen diese Händler bündeln, bis hin zu Web 3.0, wo man sogar die Aggregatoren aggregiert und so weiter. Man geht ständig eine Ebene höher. Dieses Streben nach »Meta« sehen wir seit Francis Bacon: Die Idee, die Natur zu dominieren und sich über sie zu stellen. Aber man kann der Natur nicht wirklich entkommen, weil man in ihr ist. Wir sind Teil von ihr, und sie ist Teil von uns. Doch sobald man glaubt, durch digitale Systeme über der materiellen Realität zu stehen, entsteht eine gefährliche Distanz.
Manche sagen, wir erleben heute eine Form von »Techno-Feudalismus«. Andere sprechen von einem radikalisierten Kapitalismus. Wie würden Sie es nennen?
Ich verstehe beide Bezeichnungen. Viele Leute, die diese Systeme leiten, wissen gar nicht, was Kapitalismus im historischen Sinn ist; sie denken, er sei eine Art Naturgesetz. Sie unterscheiden nicht zwischen Handel und Kapitalismus. Also streben sie zwangsläufig immer weiter nach oben, nach mehr Abstraktion und mehr Entfernung vom Konkreten. Sie hätten fast eine echte Disruption schaffen können, zum Beispiel mit der Blockchain. Doch sobald diese in Tokens verwandelt wurde, waren wir wieder im Alten gelandet. Dasselbe passierte mit dem Internet: Zunächst war es eine potenziell dezentrale Alternative zu Top-down-Medien und sollte Kreativität freisetzen. Doch am Ende haben wir Überwachung, Shopping-Plattformen und Manipulation. Bei Krypto war es anfangs ein Cyberpunk-artiger Traum, unsere eigenen Handels- und Wertsysteme zu etablieren. Aber dann wurde nur wieder auf Tokens und steigende Kurse gewettet.
Was halten Sie von der Weltraumkolonisierung durch Tech-Milliardäre? Wohin führt das, wenn Milliardäre den Weltraum dominieren?
Aus ihrer Sicht gehört ihnen am Anfang alles allein, und sie bauen riesige Schiffe für ihre kleine Elite. Vielleicht nehmen sie ein paar Dutzend junge Frauen und jede Menge Reagenzgläser mit menschlicher DNA mit. Sobald man das menschliche Erbgut digital gespeichert hat, kann man es theoretisch irgendwann »3D-drucken« und sich selbst beliebig reproduzieren. Jeff Bezos’ Vision erscheint mir im Vergleich fast »bodenständiger«, weil er auf Asteroiden nach Rohstoffen schürfen will, um die Erde weniger zu belasten. Er ist eher ein Industriekapitän, sozusagen ein moderner Rockefeller. Trotzdem will er ein Monopol. Elon Musks Vision wirkt chaotischer und noch extremer. Aber beide sind bereit, pragmatische Allianzen einzugehen, auch mit Politikern wie Trump, wenn es ihren Zielen dient.
Wie ist das Verhältnis zwischen den US-Tech-Milliardären und der neuen Trump-Regierung?
Beide Seiten verbindet eine gewisse Form von magischem Denken. Trump ist ein Meister der »positiven Visualisierung« – er glaubt, wenn man etwas nur stark genug behauptet, kann es Realität werden. Einige Tech-Milliardäre ticken ähnlich: Sie müssen daran glauben, dass sie so einzigartig sind, dass sie es wert sind, ewig am Leben gehalten zu werden. Natürlich kann es Spannungen geben. Wenn man etwa Elon Musks Vision einer Weltraumzukunft vorantreiben will, könnte man sich eines Tages von Trumps Rhetorik lösen müssen oder umgekehrt. Vielleicht verbünden sie sich aber auch längerfristig und »zügeln« sich gegenseitig auf seltsame Weise. Wir werden sehen.
Was können demokratische Regierungen tun, um die Macht der Tech-Milliardäre einzudämmen?
Ich bin kein Regierungsexperte. Ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, unsere lokalen Gemeinschaften und Beziehungen wieder aufzubauen. Wir sollten unser Nervensystem neu auf die reale Welt kalibrieren, damit wir weniger anfällig für algorithmische Manipulation sind. Wer guten Kontakt zu Familie, Nachbarn und Freunden hat, wer ein lebendiges soziales Umfeld pflegt, reagiert weniger heftig auf digitale Trigger. Wenn wir Dinge miteinander teilen, anstatt sie von Elon Musk und Co. zu kaufen, nehmen wir ihnen Macht. Wir sparen Geld, das sie sonst bekommen würden, und können so neue Räume für demokratischere Strukturen schaffen. Sie bekämpfen Demokratie, meist mit Geld. Wenn wir ihnen jedoch weniger davon geben, indem wir ihre Produkte und Plattformen seltener nutzen, verringern wir ihren Einfluss. Außerdem sollten wir Personen wählen, denen Themen wie Bildung, Kinder, Gemeinwohl und Bürgerbeteiligung am Herzen liegen.
In den USA scheint im Moment das Gegenteil zu passieren: Viele Regierungspositionen werden von Milliardären oder TV-Promis besetzt. Das zu stoppen, ist schwer, vor allem wenn autoritäre Maßnahmen greifen. Aber dass sich Menschen in der Nachbarschaft gegenseitig helfen und Dinge verleihen, kann man schwer unter Strafe stellen. Genau dort liegt eine Chance. Wenn wir uns auf lokaler Ebene verbinden und gemeinsam handeln, macht uns das nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch psychisch gesünder. So verlieren wir die Faszination für die kruden Fantasien einiger weniger mächtiger, aber durchaus kranker »Tech-Bros«.
Müssten wir nicht die Tech-Monopole wie Google mit politischen Mitteln zerschlagen und bestimmte Technologien stärker regulieren?
Ja, ich finde das auch wichtig. Cory Doctorow zum Beispiel setzt sich dafür ein, Monopole zu brechen. Europa ist da teilweise schon aktiver als die USA. Allerdings sehen wir dann oft nur so etwas wie die Cookie-Banner, die man anklicken muss, was die Lage nicht unbedingt grundlegend ändert. Trotzdem könnte Europa beispielsweise unabhängige, eigene KI-Modelle aufbauen, statt sich auf amerikanische Systeme zu verlassen, die vielleicht auf einseitige Ideologien trainiert sind. Wenn wir unsere Kultur und Werte weiterentwickeln wollen, sollten wir vorsichtig sein: KI zu verwenden, die in einem rein US-amerikanischen Kontext entstanden ist, könnte gefährlich sein. Es wäre besser, KI-Modelle zu fördern, die nicht nur das »wahrscheinlichste«, sondern auch alternative Möglichkeiten generieren und so eine echte Vielfalt ermöglichen.