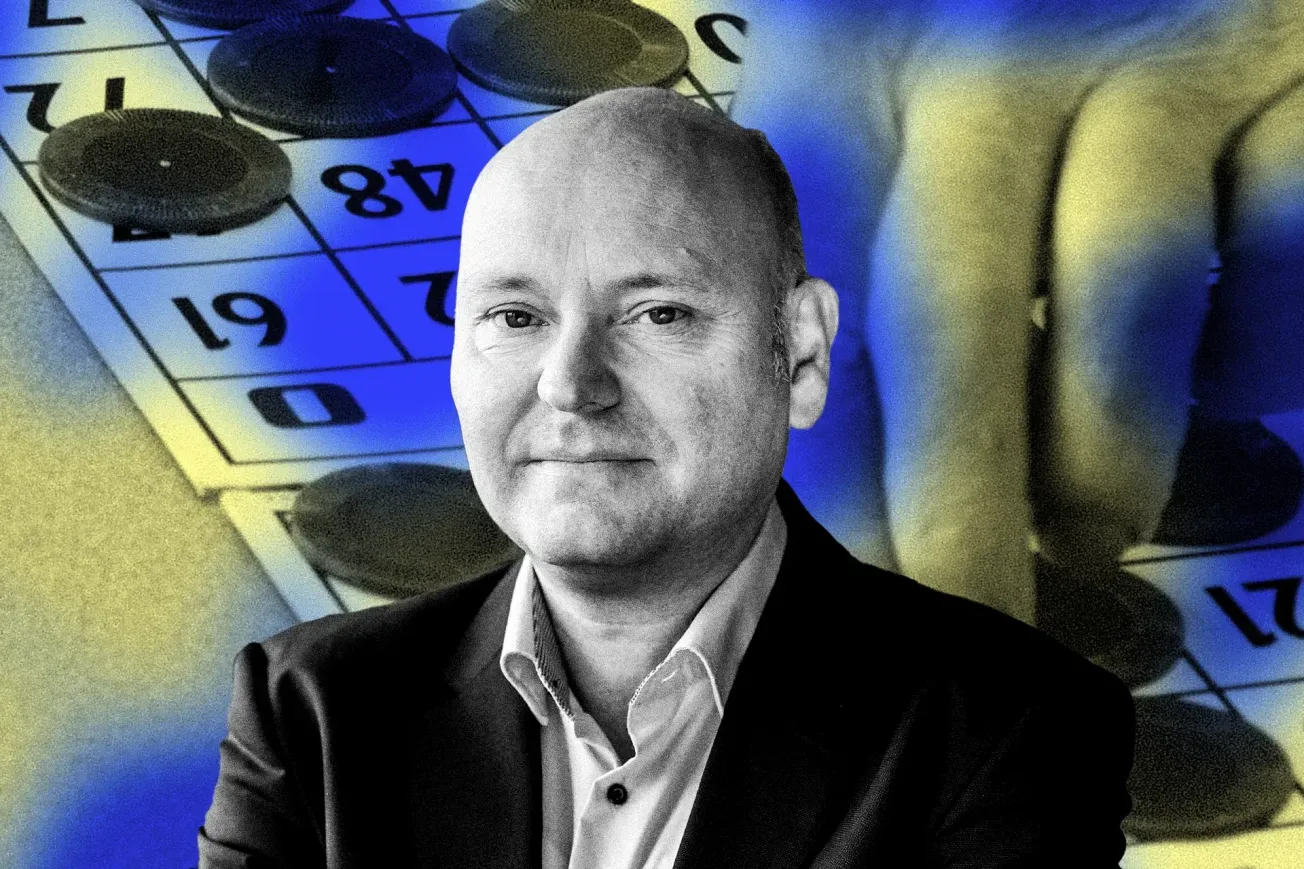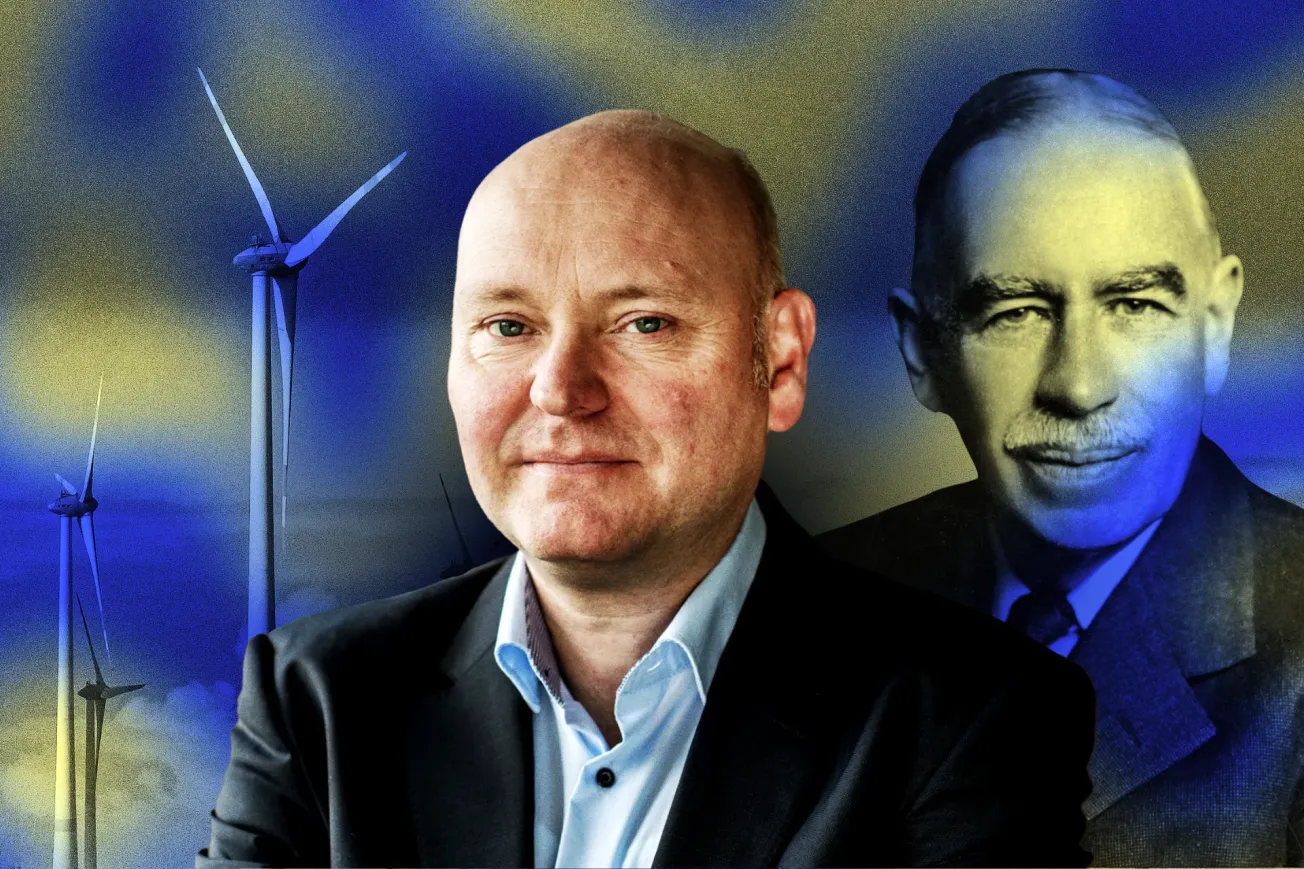Derzeit wird wieder einmal massiv gegen die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) mobilisiert. Auf allen Kanälen wird Alarm geschlagen. Das System sei nicht mehr finanzierbar, fahre vor die Wand, stehe vor dem Kollaps, bedürfe also dringend einer Reform. Die Logik dahinter: Die GRV wird im Umlagesystem finanziert. Die heute Beschäftigten und ihre Arbeitgeber zahlen über den Rentenversicherungsbeitrag von insgesamt derzeit 18,6 Prozent gemeinsam je zur Hälfte die Renten der nicht mehr Beschäftigten. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern, weshalb die Beitragssätze steigen müssen. In den sehr langfristigen Projektionen, etwa des Sachverständigenrats Wirtschaft (SVR), steigt der Beitragssatz bis zum Jahr 2035 auf 21 Prozent, bis zum Jahr 2080 dann auf 24 Prozent. Das wird als ökonomisch untragbar und zudem als ungerecht gegenüber der jüngeren, arbeitenden Generation eingestuft, weshalb zahlreiche Reformvorschläge kursieren. Die beinhalten oft, dass die Rente niedriger ausfallen soll. Der Effekt: Die Beitragssätze müssten weniger stark steigen. Allerdings würde auch das Sicherungsniveau kräftig sinken. Mit nur 48 Prozent des durchschnittlichen Lohnes in der Erwerbsphase ist es derzeit schon nicht gerade großzügig bemessen. Zusammen mit den im gegenwärtigen System ohnehin schon angelegten Senkungen, fiele es bis zum Jahr 2080 auf gerade einmal 40 Prozent. Das aber würde eine Absicherung des früheren Lebensstandards aus der GRV de facto endgültig unmöglich machen – und für viele Menschen Altersarmut bedeuten.
Die Kolumne »Eine Frage des Geldes« von Achim Truger direkt ins Postfach bekommen:
Viel zu optimistische Renditeannahmen
Doch dafür zaubern die Rentenreformer in Politik und Wissenschaft eine ganz fantastische Lösung aus dem Hut: den Ausbau der privaten kapitalgedeckten Rente. Ab sofort investieren die Beschäftigten möglichst verbindlich 4 Prozent vom Brutto monatlich in breit gestreute, risikoarme, stark aktienbasierte und globale Kapitalmarktfonds mit niedrigen Gebühren und starken Renditen. Zwar gebe es dann im Übergangsprozess eine zusätzliche Belastung für die Beschäftigten, aufgrund der renditestarken Anlage erwerben sie aber persönliches privates Kapital, wodurch sich mit den Jahren das erzielbare Sicherungsniveau erhöhe: nach den Berechnungen des SVR bis zum Jahr 2080 um sagenhafte 26,9 Prozentpunkte. Da fiele doch die Kürzung des GRV-Niveaus um gerade mal knapp 8 Prozentpunkte kaum noch ins Gewicht!
Leider hat diese »Lösung« einige Haken und birgt massive Risiken. Erstens würde sich die Gesamtbelastung der Beschäftigten für die Altersvorsorge mit einem Schlag um volle 4 Prozentpunkte erhöhen, die sie anders als in der GRV ohne Beteiligung der Arbeitgeber komplett alleine tragen müssten. An dieser Stelle wird gerne eingewandt, das sei egal, weil es sowieso keinen Unterschied mache, wer die Abgabe formal abführe, denn die ökonomische Lastverteilung ergebe sich unabhängig davon aus Überwälzungsprozessen am Markt. Wie ernst das Argument wirklich gemeint ist, kann man daran ersehen, dass noch nie vorgeschlagen wurde, die Arbeitgeber könnten den Beitrag zur privaten Altersvorsorge dann ja auch zu 100 Prozent für ihre Beschäftigten übernehmen. Damit wird auch klar, worum es bei den ganzen Rentenreformen wirklich geht: die Entlastung der Arbeitgeberseite. Die Nonchalance, mit der eine zusätzliche Belastung von 4 Beitragspunkten bei der privaten Rente für unproblematisch gehalten wird, während der bis 2080 prophezeite Anstieg um 2,7 Punkte für die Beschäftigten in der GRV für untragbar erklärt wird, ist durchaus verdächtig.