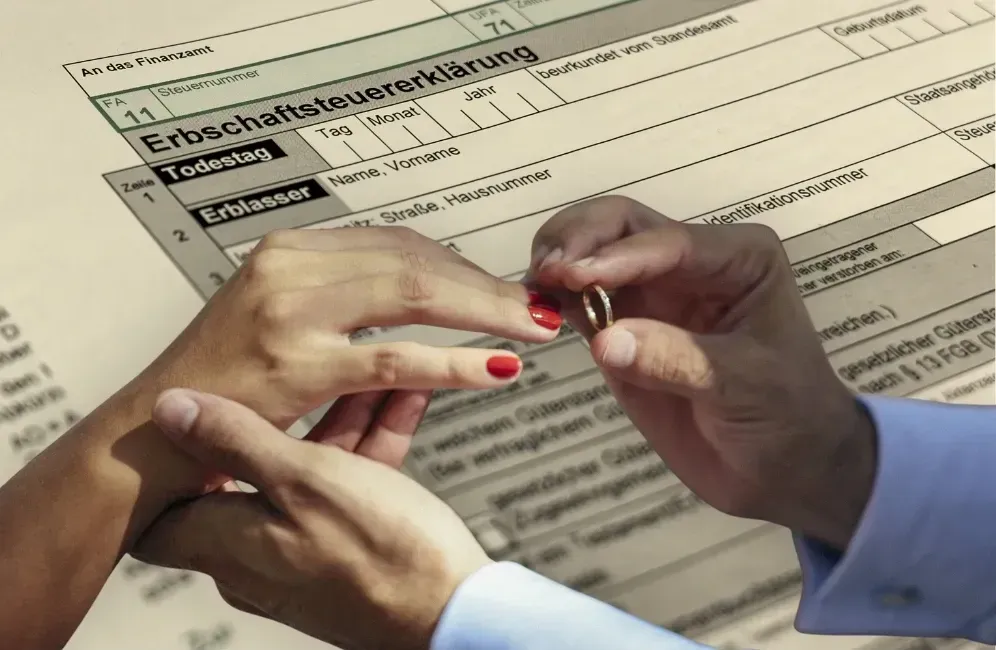Katharina Beck ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen und hat eine umfassende Studie zur Erbschaftsteuer in Auftrag gegeben, die systematisch die großen Schieflagen und Begünstigungen im aktuellen System analysiert. Die Untersuchung zeigt, wie sehr wenige, aber extrem große Erbschaften die öffentlichen Einnahmen bestimmen und wie hoch die Steuerausfälle durch Ausnahmen für Betriebsvermögen tatsächlich sind. Im Interview mit Surplus erklärt sie, warum die Steuer derzeit extrem ungerecht gestaltet ist und wie sie reformiert werden könnte.
Frau Beck, bei der Erbschaftsteuer gibt es derzeit hohe Steuervergünstigungen beim Betriebs- und Unternehmensvermögen. Ist das gerechtfertigt?
Die Steuer ist eigentlich progressiv gestaltet: Wer wenig erbt, sollte weniger abgeben müssen, wer viel erbt, mehr. Doch die Erbschaftsteuer ist im Effekt aufgrund zahlreicher Ausnahmen heute regressiv. Inhärent ist die Erbschaftsteuer damit ungerecht. Gerade bei den Riesenerbschaften über 26 Millionen Euro hatten wir durch die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung im vergangenen Jahr einen Steuererlass von 95 Prozent. Das ist eine Sonderregel im Erbschaftsteuerrecht. Sehr große Unternehmensvermögen können fast vollständig steuerbefreit werden, wenn die Erbin oder der Erbe nachweist, dass er oder sie die Steuer aus dem Privatvermögen nicht zahlen kann. Wer mittelviel erbt, zahlt heute prozentual deutlich mehr Steuern, als wer sehr viel erbt. Und deswegen ist es auch erstmal komplett unpolitisch, festzuhalten, dass die Erbschaftsteuer heute im Effekt sehr ungerecht ist.
2016 haben die Grünen die Erbschaftsteuerreform mitgetragen. Ist die Position in der Partei heute eine ganz andere?
Das ist jetzt neun Jahre her und wir haben eine sehr klare Beschlusslage. Wir haben schon im Mai einen Antrag in den Bundestag eingebracht, wo wir die Abschaffung der Verschonungsbedarfsprüfung und Umwandlung in Stundungen, also den Aufschub von Zahlungen, fordern. Es gibt ja noch andere Absurditäten, wie dass man 300 Wohnungen auf einmal steuerfrei verschenken oder erhalten darf – drei aber nicht. Und da sagen wir: Natürlich müssen diese krassen Ungerechtigkeiten abgeschafft oder durch bessere Lösungen ersetzt werden. Und wenn Sie sich fragen, ob das den Grünen wichtig ist, dann empfehle ich Ihnen, zu gucken, wie das Ranking bei den sogenannten V-Anträgen für den Parteitag Ende November war. Durch die kann die Parteibasis entscheiden, was für sie wichtig ist. Da gab es über 70 Einreichungen: Die Gerechtigkeitslücken auch in der Erbschaftsteuer zu schließen, war den Mitgliedern das wichtigste Anliegen, und zwar mit Abstand.
Sie haben eine DIW-Studie in Auftrag gegeben, die verschiedene Erbschaftsteuermodelle durchspielt. Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Der Status quo der Erbschaftsteuer ist sehr komplex, und mit unserer Studie wollen wir eine wissenschaftliche Grundlage für die politische Diskussion schaffen. Wir haben daher diverse relevante Regeln und Faktoren überprüfen lassen. Das Besondere ist, dass es bei den hohen Betriebsvermögen ja oft nur um sehr wenige Fälle geht. Deshalb sind die jährlichen Einnahmen auch volatil. Daten aus der Antwort der Bundesregierung auf eine »Kleine Anfrage« von uns zeigen, dass durch die Verschonungsbedarfsprüfung seit 2021 in insgesamt 105 Fällen Steuern in Höhe von 7,4 Milliarden Euro erlassen wurden. 2024 waren es hiervon allein 45 Fälle mit 3,4 Milliarden Euro Steuererlass.
Das Gutachten rechnet mit Mindereinnahmen durch die Begünstigung von Betriebsvermögen von insgesamt knapp acht Milliarden Euro pro Jahr. Das passt gut zu anderen Quellen: Der aktuelle Subventionsbericht der Bundesregierung weist 8,8 Milliarden Euro an Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen aus. Neben der 26-Millionen-Ausnahme sind hier weitere Regelungen enthalten, die vielen wenig bekannt sind – insbesondere jene für sogenanntes »begünstigtes Vermögen«.
Hier kann man, vereinfacht gesagt, erhebliche Steuererleichterungen erhalten: Wenn ein Betrieb und seine Arbeitsplätze fünf Jahre lang fortgeführt werden, können bis zu 85 Prozent steuerfrei übertragen werden. Bei einer Fortführung über sieben Jahre sind sogar bis zu 100 Prozent möglich. Diese Regelungen sind also sehr weitreichend und umfassend. Die große Herausforderung besteht nun darin, in einer ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Lage zu entscheiden, wie man mit diesen weitreichenden Begünstigungen künftig umgehen soll.