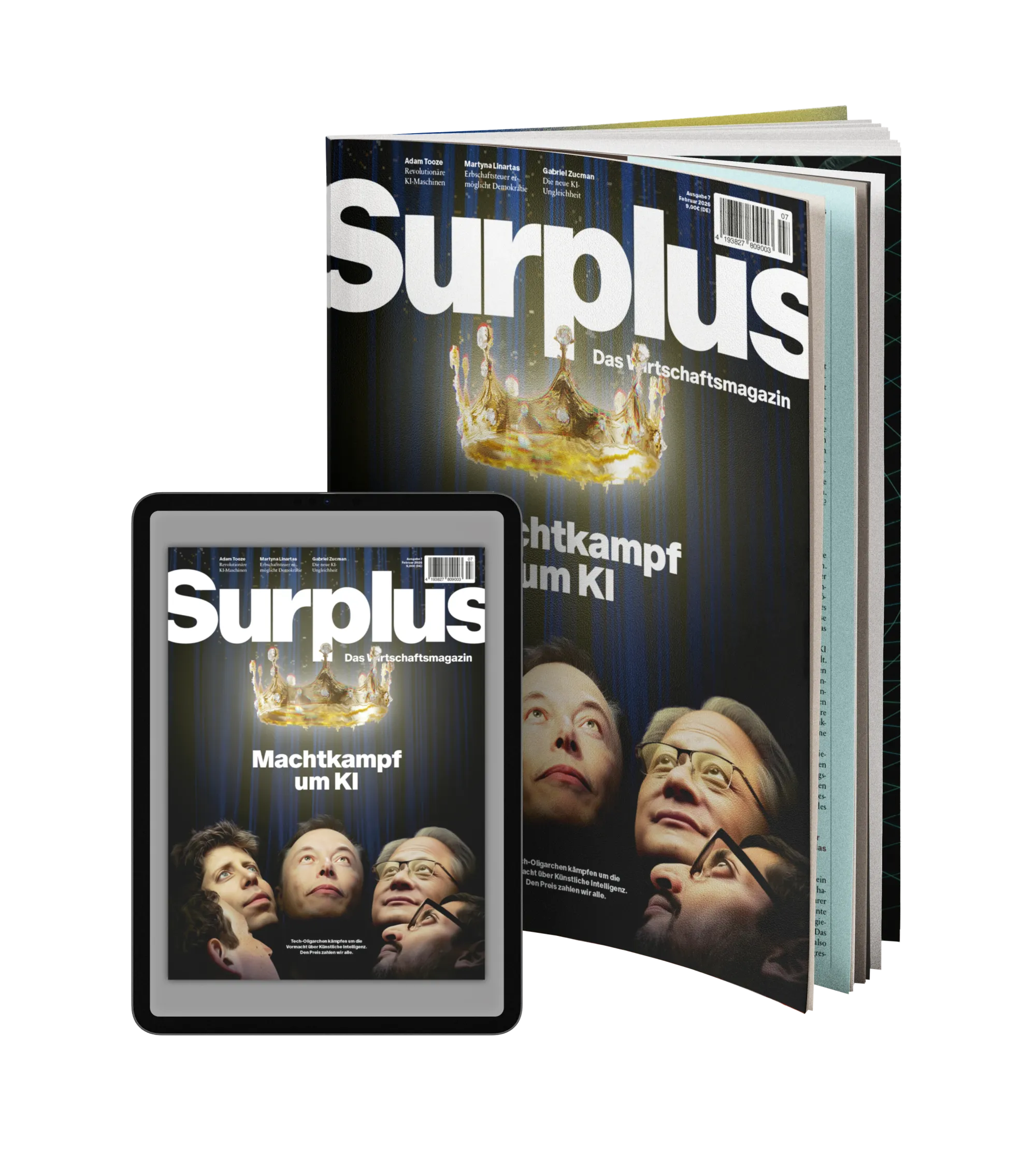US-Präsident Donald Trump erklärte vor seiner Abreise zum Weltwirtschaftsforum in Davos, es gebe »kein Zurück« mehr bei seinem Plan, Grönland zu übernehmen. Die europäischen Regierungen machen verständlicherweise keine Anstalten, auf ein solches Ansinnen einzugehen, und entsandten sogar militärisches Personal in das arktische Gebiet – woraufhin Trump mit Zöllen von 10 und ab Juni von 25 Prozent auf Importe aus acht EU-Staaten drohte.
Die politische Zuspitzung verursacht eine erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten. Zum Wochenauftakt gerieten US-Aktien deutlich unter Druck. Der S&P 500 verlor in den vergangenen Tagen rund 750 Milliarden Dollar an Börsenwert. Die Verluste entsprächen in ihrer Größenordnung in etwa dem geschätzten Wert Grönlands. Parallel dazu bewegte sich der Anleihemarkt: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zeitweise auf rund 4,29 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Monaten. Steigende Renditen gelten an den Märkten als Ausdruck wachsender Unsicherheit und erhöhter Risikowahrnehmung. Investoren preisen nicht nur mögliche neue Zölle ein, sondern auch deren Zweitrundeneffekte: eine mögliche Eskalationsspirale im Handelsstreit, höhere Inflation, größere Haushaltsdefizite und steigende Finanzierungskosten für Unternehmen und private Haushalte
Europas Suche nach einer Antwort
In den europäischen Hauptstädten wird unterdessen intensiv darüber beraten, wie auf Trumps Vorgehen zu reagieren ist. Der im Sommer 2025 beschlossene Zolldeal mit den USA wurde bereits vertagt. Zudem rückt das Anti-Coercion-Instrument der EU stärker in den Vordergrund, die sogenannte »Handelsbazooka«. Das Instrument wurde geschaffen, um wirtschaftlicher Erpressung durch Drittstaaten zu begegnen, und gilt in Brüssel als schärfstes handelspolitisches Schwert. Das Instrumentarium reicht von gezielten Strafzöllen über Ein- und Ausfuhrbeschränkungen bis hin zu Eingriffen bei Direktinvestitionen und öffentlichen Aufträgen.
Einzelne europäische Akteure gehen zudem mit symbolischen Schritten voran. So kündigte ein großer dänischer Pensionsfonds an, Bestände an US-Staatsanleihen zu verkaufen. In der politischen Debatte dienen solche Maßnahmen als Beleg, dass Europa durchaus über Hebel verfügt, um wirtschaftlichen Druck aufzubauen. Doch gerade an diesem Punkt droht eine strategische Fehleinschätzung.
Gefährliche Illusionen über ökonomische Macht
Der Verkauf von US-Staatsanleihen oder die Einschränkung europäischer Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten mögen auf den ersten Blick als wirksame Drohkulisse erscheinen. Ökonomisch betrachtet würden solche Maßnahmen Europa jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit stärker schaden als den USA.

Heiner Flassbeck, Patrick Kaczmarczyk: Zerfall der Weltordnung
Die Ignoranz des Westens und der Aufstand des Globalen Südens. Erscheint am 2. Februar 2026 im Westend Verlag.
Zwar zählen europäische Länder, insbesondere Deutschland, zu den bedeutenden Gläubigern der Vereinigten Staaten. Dieser Umstand ist jedoch keine Quelle politischer Macht, sondern das Ergebnis struktureller Leistungsbilanzüberschüsse. Europa exportiert seit Jahren mehr Güter in die USA, als es von dort bezieht. Im Warenhandel beläuft sich das bilaterale Defizit der USA gegenüber der EU auf knapp 200 Milliarden Euro. Im Dienstleistungshandel liegt hingegen ein Defizit Europas von rund 110 Milliarden Euro vor, wobei ein erheblicher Teil auf konzerninterne Verrechnungen multinationaler Unternehmen zurückzuführen ist.
Diese Überschüsse implizieren, dass Europa mehr produziert als es konsumiert – und die Mehrproduktion, die mit positiven Beschäftigungseffekten und finanziellem Vermögensaufbau einhergeht, wird durch die USA absorbiert. Die Kehrseite dieser Position ist damit eine wirtschaftliche Abhängigkeit: Europäische Nachfrage wird durch amerikanische Importe gestützt, während europäische Unternehmen – vor dem Hintergrund schwachen Lohnwachstums und verhaltener Binnennachfrage – in besonderem Maße auf Absatzmärkte außerhalb Europas angewiesen sind. Der US-Markt spielt dabei wegen seiner Kaufkraft und Investitionsdynamik eine zentrale Rolle.