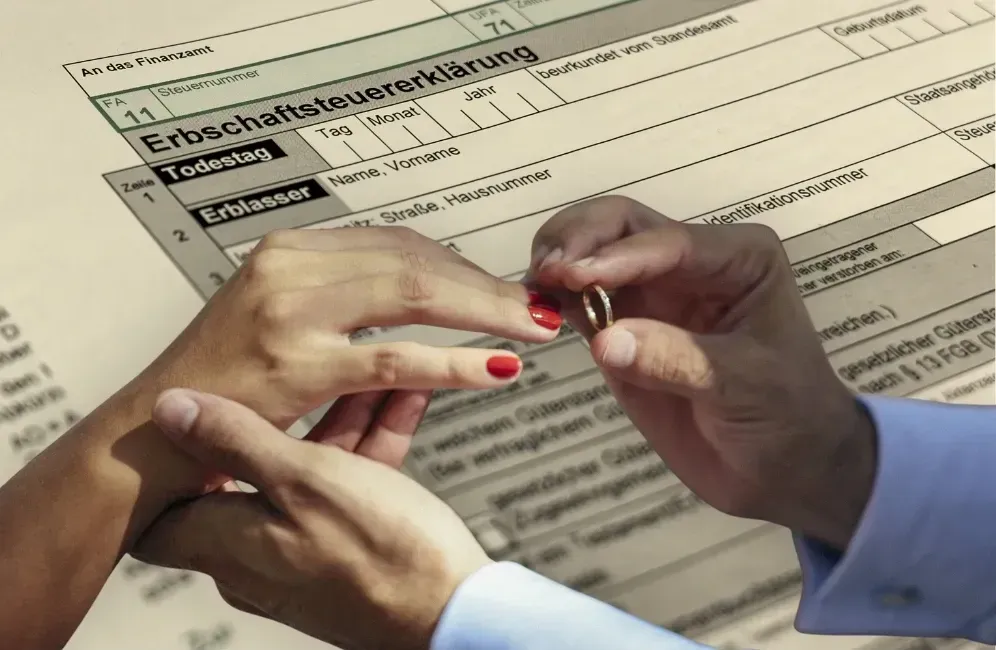In einem Brief fordern über 50 Frauen aus Kultur, Wissenschaft und Politik echten Schutz von Frauen vor Gewalt. An Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gewandt wollen sie »über Sicherheit für Töchter, also Frauen sprechen«, heißt es in dem Brief, der Surplus vorliegt. Allerdings wolle man das »ernsthaft tun, und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative gerechtfertigt werden sollen«. Zu den Unterzeichnerinnen gehören neben der Surplus-Herausgeberin Isabella Weber und der Surplus-Kolumnistin Luisa Neubauer auch die Autorin Alice Hasters, die Grünen-Politikerin Ricarda Lang, die Schauspielerin Melika Foroutan, die Soziologin Jutta Allmendinger, sowie die Autorin Mithu Sanyal. Zuerst berichtete der Spiegel über den öffentlichen Brief.
Mit ihrem Brief an Merz reagieren die Unterzeichnerinnen auf die von ihm ausgelöste »Stadtbild«-Debatte. Er sprach davon, es gebe »natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen«. Auf eine spätere Nachfrage, was er damit gemeint habe, antwortete er: »Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort.« Zuletzt unterstrich der Kanzler am vergangenen Mittwoch, »Probleme würden diejenigen Migranten machen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, die nicht arbeiteten und die sich auch nicht an die in Deutschland geltenden Regeln hielten.«
Diese Aussagen haben eine Debatte ausgelöst. Einerseits ist Merz Rassismus vorgeworfen worden, weil er die »Probleme im Stadtbild« mit Rückführungen verknüpft hat. Andererseits, dass er den Feminismus für diese Aussagen missbraucht. Kritikerinnen sprachen von »Femonationalismus«: ein soziologischer Begriff dafür, wenn queere oder weibliche Personengruppen für nationalistische Argumentationen instrumentalisiert werden, sie zum Beispiel als besonders schützenswert und hingegen migrantische Gruppen als für sie gefährlich dargestellt werden. Die Frauen grenzen sich in ihrem Brief von derartigen Argumentationen ab. Sie fordern »einen öffentlichen Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen«. Dabei dürften »Betroffene von Sexismus und Betroffene von Rassismus« jedoch »nicht gegeneinander ausgespielt werden«.
In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke Mediengruppe gaben 55 Prozent der befragten Frauen an, sich an keinem der zur Auswahl stehenden öffentlichen Orte sicher zu fühlen. Darunter waren unter anderem die Straße, öffentliche Verkehrsmittel oder Parks. Am schlechtesten schnitten Clubs und Bahnhöfe ab – nur 14 Prozent der Frauen gaben an, sich dort sicher zu fühlen.
Die zehn Forderungen
In dem Brief listen die Unterzeichnerinnen folgende »10 Forderungen für mehr Sicherheit für Töchter in Deutschland« auf:
- Bessere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt: konsequente Ermittlungen, schnellere Verfahren, Schulungen für Polizei und Justiz zu geschlechtsspezifischer Gewalt; verpflichtende Weiterbildungen von Richter*innen und Staatsanwält*innen im Familienrecht; Finanzierung von mehrsprachigen, kultursensiblen Beratungsangeboten und Schutzräumen für migrantische Frauen
- Bessere Beleuchtung und Überwachung öffentlicher Räume: Sichere Wege, besonders an Bahnhöfen, Haltestellen und in Parks.
- Femizide ins Gesetzbuch aufnehmen: Strategie zur aktiven Prävention von Femizide
- Verlässliche Datenerhebung zu Gewalt gegen Frauen – differenziert nach Diskriminierungserfahrungen: Um eine umfassende und gezielte Präventionsstrategie und -politik zu ermöglichen
- Ausreichend finanzierte Frauenhäuser und Schutzräume – für alle Frauen- und Gewalthilfegesetz konsequent umsetzen: Zugang auch für Frauen mit Behinderung oder Sprachbarrieren. Keine Diskriminierung nach Herkunft, Religion oder Aufenthaltsstatus: Ausbau von Prävention
- Gewaltschutzgesetz finanzieren und Anerkennung rassistisch motivierter Gewalt in Gesetzgebung und Praxis: Beispielsweise Schutz für muslimische, Schwarze, Roma- und asiatisch gelesene Frauen vor Hassverbrechen
- Schutz vor digitaler Gewalt und Rassismus im Netz: Strengere Regeln gegen Online-Hass, Cybermobbing, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus und Deepfakes. Lückenlose Durchsetzung des Digital Service Acts
- Recht auf körperliche Selbstbestimmung einführen, durch die Reform von Paragraf 219 & 218: Dabei das Gender Health Gap schließen
- Finanzielle Unabhängigkeit von Frauen stärken: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere Absicherung Alleinerziehender und Schutz vor ökonomischer Gewalt und geschlechtergerechtes Steuersystem
- Altersarmut von Frauen konsequent bekämpfen
Damit fordern die über 50 Frauen einen umfassenden Schutz für Frauen: auf den Ebenen von Justiz, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft – als auch intersektional. Neben Forderungen, die das »Stadtbild« betreffen, zum Beispiel besser ausgeleuchtete öffentliche Räume, sollen Frauen demnach auch zu Hause besser geschützt werden – ob im Internet oder dadurch, dass sie von Gewalt in Partnerschaften oder der Familie besser fliehen können, weil Frauenhäuser besser finanziert sind. Nicht zuletzt docken die Forderungen auch an den ökonomischen Wurzeln für die Abhängigkeit von Frauen an. Wie die Publizistin und Rechtsanwältin für Familienrecht Asha Hedayati bei Surplus schreibt, erschweren drohende Armut und mangelnde öffentliche Versorgung Frauen, sich aus gewaltvollen Beziehungen zu befreien.
Die Wirtschaftspolitik hinter den Forderungen
Viele der Forderungen haben einen wirtschaftspolitischen Kern, manche indirekt und manche direkt. Indirekt dort, wo es um eine bessere Finanzierung geht: bessere Strafverfolgung, bessere Beleuchtung, ausfinanzierte Frauenhäuser. Gerade in Zeiten einer Kürzungspolitik im Kernhaushalt, wie wir sie schon sehen und wie sie noch stärker droht, scheitern diese Fragen auch an der finanzpolitischen Realität. Damit können Forderungen nach einem Ende der Schuldenbremse und einer Vermögensteuer auch implizit den Frauenschutz erhöhen, indem die zusätzlichen Spielräume für diese Projekte genutzt werden. Noch viel direkter wird die wirtschaftspolitische Bedeutung sichtbar bei den Forderungen nach finanzieller Unabhängigkeit der Frauen sowie beim Bekämpfen der Altersarmut. Dagegen helfen gleiche Löhne für gleiche Arbeit, Anerkennung von Sorgearbeit und der Wiederaufbau eines Sozialstaats, der echte Daseinsvorsorge bieten kann.
Beitrag zu einer fundierten Debatte
Die Forderungen der über 50 Frauen kritisieren richtigerweise beide Formen, in denen Merz' Aussagen diskriminierend waren: Einerseits darin, dass er mit ihnen migrantische Männer aus der Gesellschaft ausschließt, und andererseits, dass er hierfür (weiße) Frauen instrumentalisiert. In der aktuellen Debatte muss beides zusammengedacht werden. Männer, die im öffentlichen Raum als migrantisch wahrgenommen werden, sind häufiger sogenannten »anlasslosen« Polizeikontrollen ausgesetzt. Abschiebungen werden von der Bundesregierung immer öfter als das Allheilmittel für die Probleme in Deutschland ausgegeben – und Merz' Aussagen dürften zu diesem Ressentiment beitragen.
Gleichzeitig kümmert sich die Union nicht wirklich um Frauen und queere Personen. Sie schiebt sie lediglich vor, wenn sie gegen andere Gruppen hetzen will. In Berlin will der SPD-CDU-Senat beim Gewaltschutz für Frauen wichtige Gelder für Frauenhäuser und weitere Hilfestellen, insgesamt 2 Prozent, streichen – obwohl deren finanzieller Bedarf stark steigt. Währenddessen, so berichtete der Tagesspiegel, ist die Zahl der in Berlin von Gewalt betroffenen Frauen im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Demnach seien 2024 insgesamt 42.751 Frauen Opfer von Gewalt geworden – ein Plus von 7,5 Prozent. Vorschläge, diese Entwicklung aufzuhalten, gibt es in der öffentlichen Debatte kaum, werden nun jedoch in dem Brief an Merz geliefert. Damit nehmen die Unterzeichnerinnen Merz weiteren Wind aus den Segeln. Mit seinen Behauptungen deutete er an – und weitere Politiker wie der Grünen-Chef Felix Banaszak oder Unions-Fraktionschef Jens Spahn stiegen darauf ein – es seien vor allem linke oder progressive Kritikerinnen, die »die Realität« in den Städten nicht sehen würden. Mit ihrem Debattenbeitrag zeigen die über 50 Frauen: Sie sehen die Realität sehr wohl und liefern auch noch konkrete Lösungen, statt nur den Diskurs für eigene Zwecke zu manipulieren.
Also: Es geht darum, »Töchter« und »Söhne« zu schützen – aber auf eine andere Art, als Merz es suggeriert: die »Töchter« vor gewaltvoller Männlichkeit, ökonomischer Abhängigkeit und Rassismus, die »Söhne« vor rassistischen Reinigungsphantasien, und allesamt davor, für Hetze gegen die jeweils anderen instrumentalisiert zu werden.
Quelle: mit dpa