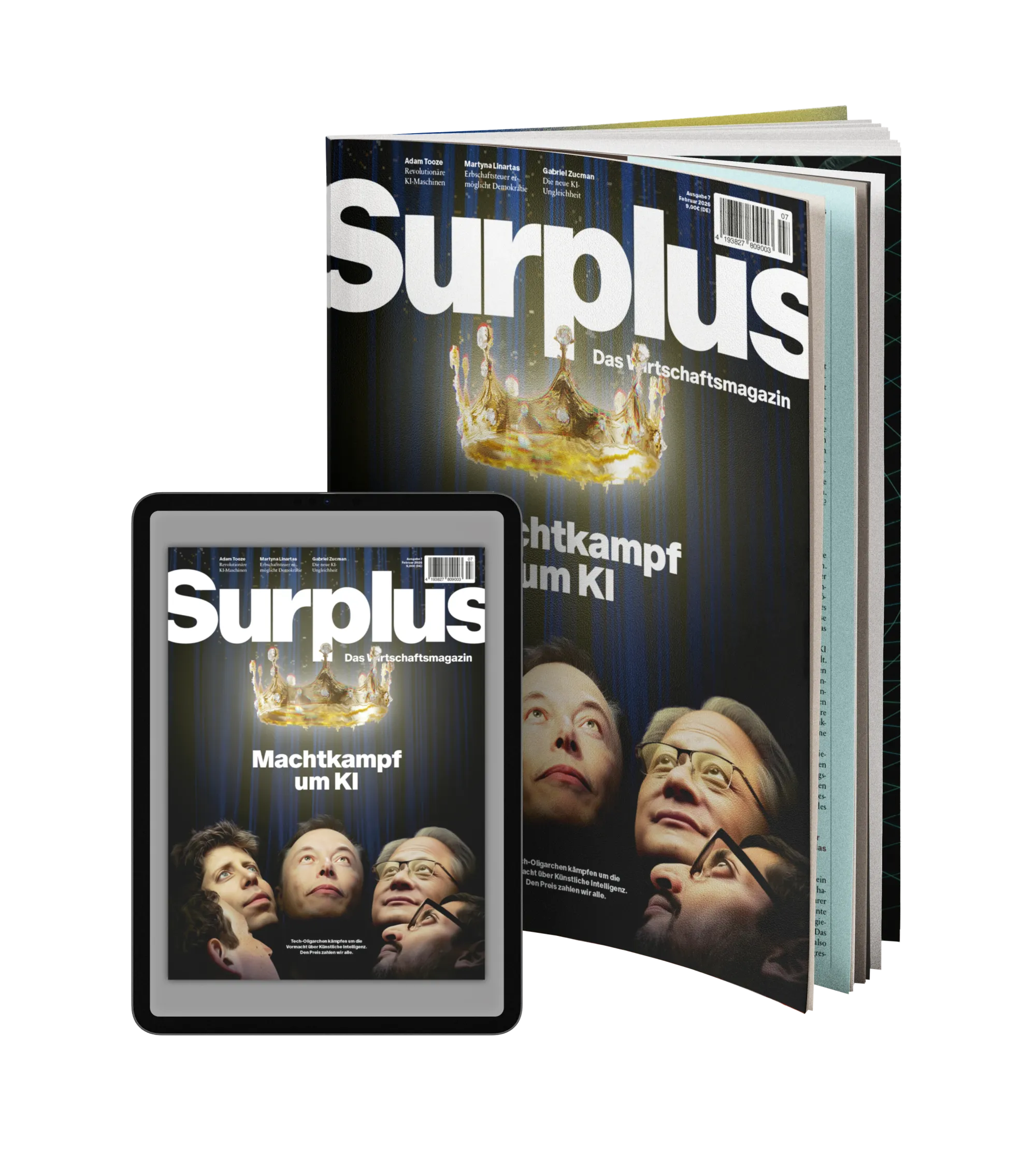Am 10. Januar 2026, wenige Wochen vor dem sechsten Jahrestag des Anschlags von Hanau, starb Ibrahim Akkuş im Alter von 70 Jahren. Am 19. Februar 2020 hatte ein Rechtsextremer in der Arena Bar achtmal auf ihn geschossen und Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin ermordet. Akkuş hatte Glück, trotz schwerer Verletzungen überlebte er, doch monatelange Krankenhausaufenthalte und mehrere Operationen folgten. Seitdem war er auf einen Rollstuhl angewiesen, gepflegt wurde er zu Hause von seiner Frau und der 18-jährigen Tochter in einer nicht barrierefreien Wohnung in Hanau. Das bedeutete auch: Die Familie konnte nicht mehr arbeiten, blieb zuhause, und Armut wurde für sie ein großes Problem. Wie für Ibrahim Akkuş, setzt sich für viele Betroffene rechter Gewalt das Leiden in einem jahrelangen Kampf nicht nur um Aufklärung, sondern auch um medizinische Versorgung und soziale Absicherung fort.
Bürokratische Hürden
In Deutschland gibt es zur Unterstützung der Opfer von Gewalt verschiedene Töpfe und Rechtswege, doch sind sie recht kompliziert gestaltet. Seit Januar 2024 gilt das neue Soziale Entschädigungsrecht im SGB XIV. Es soll Opfer von Gewalttaten entschädigen und unterstützen, nicht nur mit Therapieangeboten, sondern auch finanziell. Zentral sind monatliche Entschädigungszahlungen, gestaffelt nach dem »Grad der Schädigungsfolgen«. Die Beträge reichen von 434 bis 2169 Euro im Monat, bei schwersten Folgen erhöht sich die Zahlung auf 2603 Euro. Auf dem Papier klingt das erst einmal gut. In der Praxis beginnt hier aber oft erst die komplexe Papierarbeit.
Anträge können zwar grundsätzlich auch formlos gestellt werden, doch die Entscheidung basiert am Ende auf Akten, etwa ärztlichen Unterlagen, Gutachten, Ermittlungsdokumenten, Nachweisen über Folgeschäden. Bei körperlichen Verletzungen ist der Zusammenhang zwischen Tat und Schaden häufig leichter zu dokumentieren als bei psychischen Folgen, gerade wenn Symptome erst später auftreten oder sich mit anderen Belastungen überlagern. Und wer, wie Familie Akkuş und viele Hinterbliebene nach rassistischer Gewalt, kaum oder nicht Deutsch spricht, ist in Verfahren, die stark von Schriftverkehr leben, besonders abhängig von Unterstützung.
Weil die staatlichen Behörden bei den Verfahren nicht genügend Unterstützung leisten, landet die Verantwortung häufig bei Opferberatungsstellen. Der Dachverband der Beratungsstellen VBRG etwa beschreibt, dass viele Betroffene noch lange unter physischen, psychischen, materiellen und sozialen Folgen leiden, und fordert deshalb »schnelle, unbürokratische finanzielle Unterstützung« vom Staat. Denn Beratungsstellen wie der Weiße Ring, die Opferberatung Rheinland oder Response sind oft die Stellen, die das System für Betroffene überhaupt erst »übersetzbar« machen. Sie begleiten Betroffene zu Behörden, erklären Bescheide, die sonst kaum zu überblicken sind, helfen beim Sammeln von Unterlagen und füllen eine Lücke, die eigentlich staatlich gefüllt werden sollte. Zusätzlich sind diese Stellen oft stark von Spenden oder Fördergeldern abhängig und überlastet.
Wenn Geld da ist, aber nicht ankommt
Doch das ist nicht das einzige Problem: Wie groß die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit sein kann, zeigt sich in Hessen. Der dortige Opferfonds ist pro Jahr mit zwei Millionen Euro ausgestattet. Die Richtlinien sehen eine einmalige Unterstützung vor: mindestens 5000 Euro, in der Regel 10.000 Euro, bei langfristigen oder dauerhaften schweren Gesundheitsschäden sogar bis zu 30.000 Euro. Im Prinzip eine gute Sache, doch laut der Frankfurter Rundschau wurden im vergangenen Berichtsjahr nur 20.000 Euro bewilligt – also rund ein Prozent des Jahresbudgets.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login