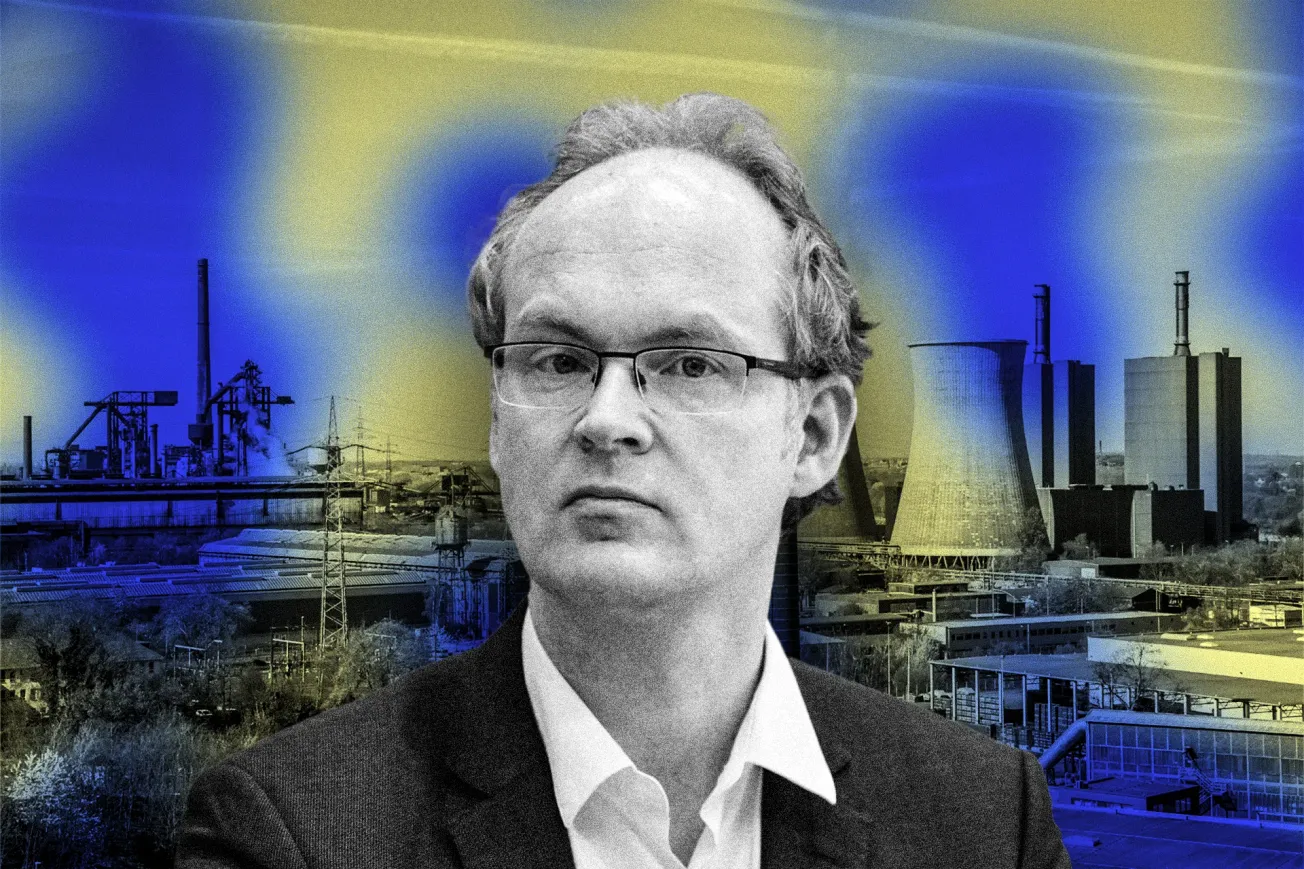Die im Koalitionsvertrag reichlich vorgesehenen industriepolitischen Maßnahmen folgen keiner klar erkennbaren Strategie. Um ihre volle Wirkung zu entfalten, sollte die Bundesregierung entlang drei zentraler Gelingensbedingungen nachsteuern: Erstens braucht es eine klare Zieldefinition – also Transparenz darüber, welche Branchen aus welchen wirtschaftspolitischen Gründen gefördert werden sollen. Zweitens ist bei der Umsetzung entscheidend, wirksame Instrumente zu entwickeln und anhand nachvollziehbarer Leistungsziele vorzugehen. Drittens sollte die Industriepolitik in marktwirtschaftliche Wettbewerbsmechanismen eingebettet und europäisch koordiniert sein, um Effizienz und Wirkung zu maximieren.
Weltweit lässt sich ein Boom industriepolitischer Aktivität beobachten. Wie Réka Juhász und Kollegen eindrucksvoll darlegen, ist vor allem seit 2010 ein massiver Anstieg des Einsatzes industriepolitischer Instrumente festzustellen. Dabei sind es zunehmend die reicheren Länder einschließlich der hoch entwickelten Volkswirtschaften, die für sich die vertikale Industriepolitik wiederentdeckt haben. In den USA hatte der unter US-Präsidenten Joe Biden eingeführte »Inflation Reduction Act« klare industriepolitische Zielsetzungen. Dabei wurden mit dem Gesetzespaket nicht nur die Produktion und Installation erneuerbarer Energien und zugehöriger Anlagen in den USA gefördert, sondern mit dem klaren Ziel einer geschlossenen nordamerikanischen Wertschöpfung auch die Produktion von E-Autos einschließlich aller Komponenten in Nordamerika. Der aktuelle US-Präsident Donald Trump versucht mit einer aggressiven Zollpolitik, Unternehmen zur (Rück-)Verlagerung von Produktion in die USA zu bewegen.
China, längst selbst kein Entwicklungsland mehr, verfolgt spätestens seit 2015 mit der »Made in China 2025«-Strategie den Ansatz, mit massiven industriepolitischen Eingriffen Schlüsselbranchen zu fördern, um in wichtigen Bereichen zur globalen Technologieführerschaft aufzuholen oder diese sogar zu erringen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass auch Deutschland ein idealer Kandidat für eine offensivere und als solche kommunizierte Industriepolitik sein könnte. Deutschlands Verarbeitendes Gewerbe ist in den vergangenen Jahren zunehmend durch geoökonomische und geopolitische Verschiebungen sowie die Industriepolitik anderer Länder massiv unter Druck gekommen. So sind die neuen US-Zölle für Deutschland insbesondere wegen der großen Bedeutung des US-Marktes für den deutschen Export schmerzhaft. Chinas »Made in China 2025«-Strategie zielt zudem auf viele Märkte, in denen bisher Deutschland führend war, was deutschen Unternehmen nicht nur den Absatz in China, sondern auch auf Drittmärkten erschwert.
Tatsächlich hat in den vergangenen Jahren auch in Deutschland die Debatte um eine neue Industriepolitik an Fahrt gewonnen. 2019 hatte der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit seiner »Nationalen Industriestrategie 2030« eine kontroverse Debatte angestoßen; der Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP für den Zeitraum ab 2021 enthielt eine Vielzahl industriepolitischer Eingriffe, auch wenn diese nicht als einheitliche Industriepolitik dargestellt wurden.