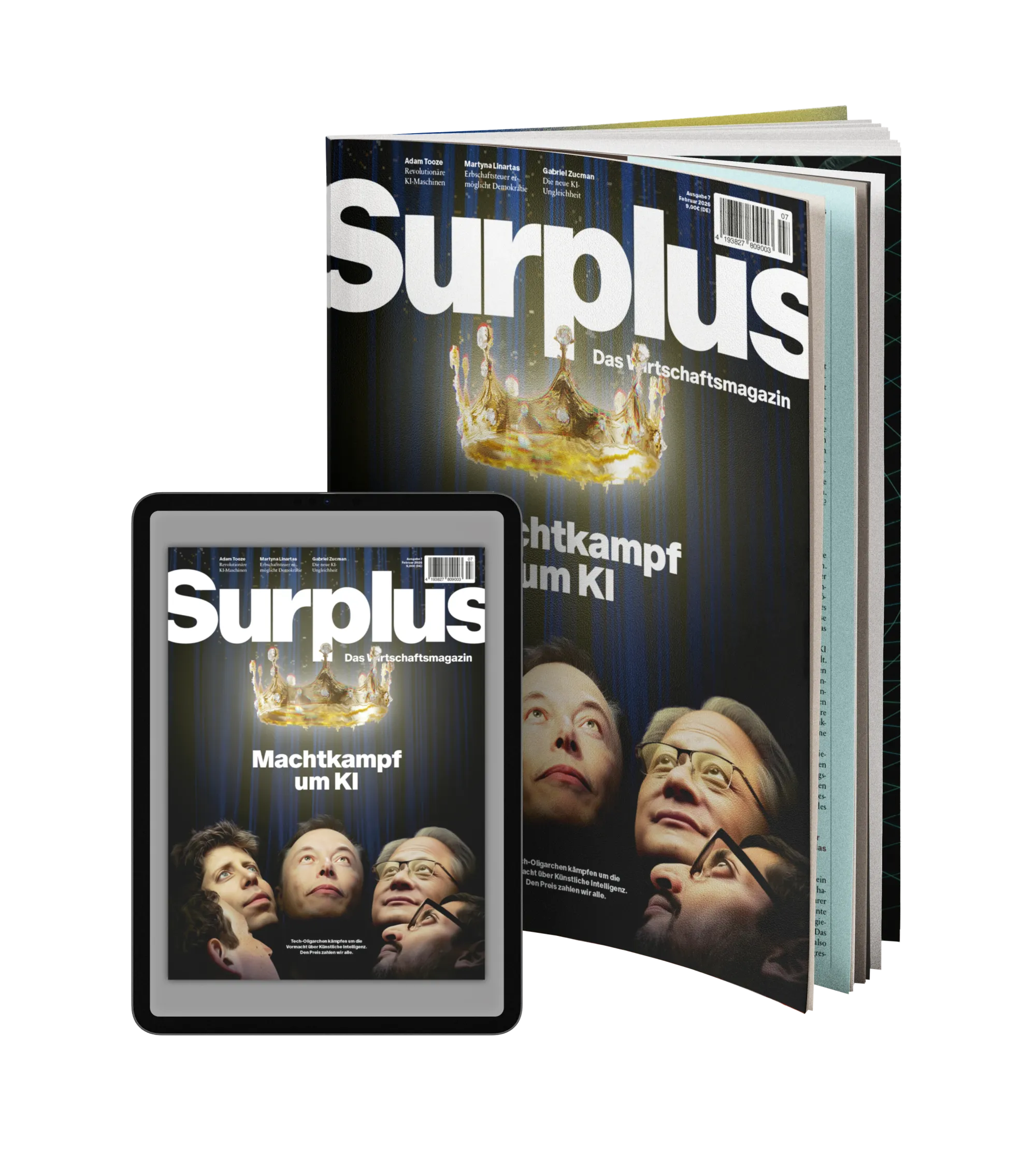Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie und derzeit eine der gefragtesten intellektuellen Stimmen Deutschlands. Zusammen mit der Grünen-Politikerin Ricarda Lang veröffentlichte er 2025 den Gesprächsband Der große Umbruch. Im Interview sprechen beide über ihre Visionen für Deutschlands wirtschaftliche und politische Zukunft.
Matthias Ubl: Ihr gemeinsames Buch heißt Der große Umbruch, gleich zu Beginn sprechen Sie über soziale Ungleichheit. Wie hängt beides miteinander zusammen?
Steffen Mau: Ungleichheit ist für uns beide auch ein biografisches Thema. Wir konnten – gerade mit Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten – gar nicht daran vorbeigehen. Zugleich gehört soziale Ungleichheit zu den zentralen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit. Wir beobachten hier dramatische Veränderungen, global ebenso wie national. Eine zentrale These des Buches lautet, dass kulturelle Themen im öffentlichen Diskurs häufig die Ungleichheitsfragen überlagern, wenn nicht sogar verdrängen. Oft geht es nur noch um Ersatzpolitik, weniger um die drängenden sozialen Fragen.
Ricarda Lang: Wir knüpfen dabei an Überlegungen an, die Steffen bereits in seinem Buch Triggerpunkte entwickelt hat. Wir beobachten eine Umdeutung sozialer Konflikte: Klassische Oben-unten-Konflikte werden zu Auseinandersetzungen zwischen Außen und Innen – etwa in der Migrationsdebatte – oder zwischen Heute und Morgen, wie beim Klimaschutz. In der Bürgergeld-Debatte werden die Armen gegen die noch Ärmeren ausgespielt, es wird nach unten getreten. Wir sind überzeugt, dass es auf die soziale Ungleichheit eine glaubwürdige progressive Antwort braucht. Die Vorstellung, man könne der Kulturalisierung sozialer Konflikte nur mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger begegnen, wird nicht funktionieren. Menschen müssen wieder daran glauben können, dass Politik tatsächlich in der Lage ist, ihre Lebenssituation zu verbessern und gerechter zu machen.
Herr Mau, Sie bringen im Buch das Konzept der Lebenschancen ins Spiel: Was ist damit gemeint?
Mau: Lebenschancen meint, dass Menschen vor dem Hintergrund ihrer Interessen ihr Leben verwirklichen können – mit möglichst viel Teilhabe und Optionen der Lebensgestaltung. Gleichzeitig darf sich die soziale Distanz zwischen den oberen und unteren Gruppen nicht immer weiter vergrößern. Eine Gesellschaft der Lebenschancen ist eine, in der Menschen tatsächlich in der Lage sind, ihre Lebensmöglichkeiten – ausgehend von ihren Talenten und Voraussetzungen – möglichst weit auszuschöpfen. Das unterscheidet sich sowohl von einer strikt egalitären Gesellschaft als auch von einer reinen Umverteilungsgesellschaft, die nur auf Ressourcen schaut. Es ist auch etwas anderes als die oft bemühte Vorstellung eines allgemeinen »Aufstiegs durch Bildung«. Wenn man Sozial- und Gesellschaftspolitik konsequent am Kriterium der Lebenschancen ausrichtet, gelangt man aus progressiver Perspektive zu anderen Ideen gesellschaftlicher Umgestaltung, als sie in den gängigen Debatten häufig im Vordergrund stehen.
Lang: In der Debatte dominiert derzeit stark die Vorstellung von »Aufstieg durch Bildung« als zentralem Gerechtigkeitsprinzip. Viele – auch in meiner eigenen Partei – argumentieren: Wenn alle die gleichen Startchancen haben, sich über Bildung nach oben zu arbeiten, dann sei das Problem im Grunde gelöst. Dann greift das meritokratische Prinzip. Immer mehr Menschen sind gut ausgebildet, und wir hatten ja tatsächlich eine massive Bildungsexpansion in den vergangenen Jahrzehnten.
Aber erstens stellt sich die Frage: Was ist mit all jenen, die in dieser Logik zurückbleiben – obwohl wir sie gesellschaftlich dringend brauchen? Ich denke etwa an das Handwerk oder die Pflege. Gleichzeitig beobachten wir eine neue Form der Prekarisierung, gerade im akademisch gebildeten Milieu. Das ist kein Randphänomen mehr. Wenn wir auf die Arbeitslosenzahlen schauen, sehen wir auf der einen Seite verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, auf der anderen Seite aber gerade bei jungen Akademikerinnen und Akademikern einen deutlichen Anstieg – viele finden schlicht keinen Job, von der Miete reden wir dann noch gar nicht. Die Vorstellung, mit Bildung allein sei das Gerechtigkeitsproblem gelöst, trägt also nicht.