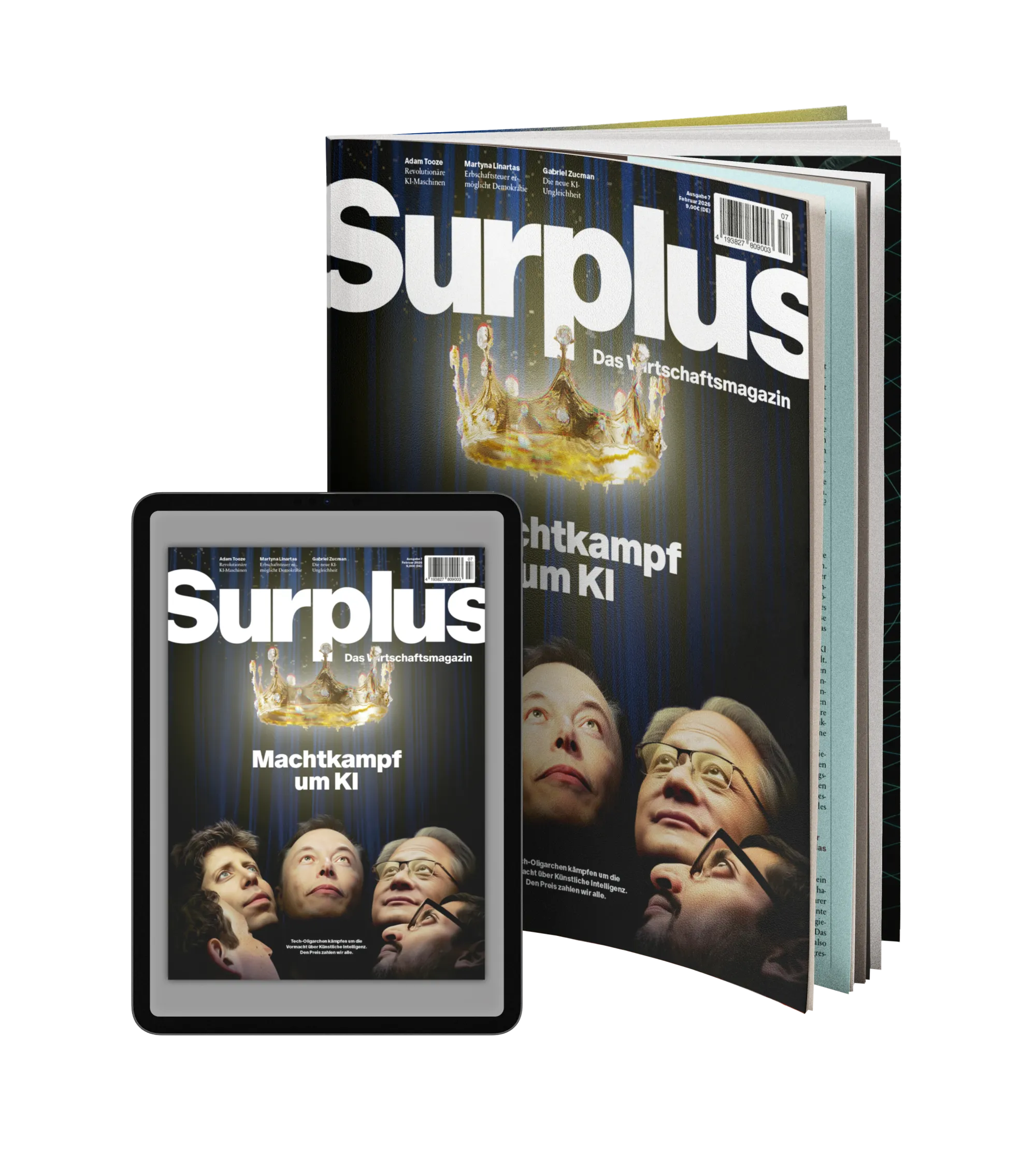Nach seinem besten Selbst zu streben, ist eine Tugend, alt wie das Feuer. Als kategorischer Imperativ ermöglicht sie ein harmonisches Zusammenleben. Als Leitlinie des Neoliberalismus macht sie unser Leben zur Ware. Zu jedem Jahreswechsel wird die Selbstoptimierung in Form von Neujahrsvorsätzen überschwänglich mit Bedeutung aufgeladen. Seit 2014 kehrt ein und dieselbe Illustration jährlich kurz vor Silvester mit immer neuen Jahreszahlen auf unsere Instagram-Feeds zurück, wenn auch zuletzt eher als Meme. Es zeigt eine Frau, die von der Stufe 2014 auf die Stufe 2015 steigt, »Negativität«, »Fake Friends« und »Heartbreak« hinter sich gelassen, einen Beutel gefüllt mit »God«, »Love«, »Focus« und »Peace« über den Rücken geschwungen ins nächste Jahr tragend. Was jeweils zurückgelassen oder mitgenommen wird, ist austauschbar, das Jahr 2026, so heißt es jetzt, sollen Labubus und Dubai-Schokolade nicht erreichen dürfen.

Gleich bleibt: Jedes neue Jahr muss besser als das vorherige werden. War das Jahr zuvor ein schlechtes, muss am 1. Januar alles Altbekannte über Bord geworfen, der eigene Leib für den Anblick von außen zurechtgestutzt und die mentale Verfassung für die fortwährende Lohnarbeit zugerichtet werden. War das Jahr ein gutes, muss das »Gute« vervielfacht und intensiviert werden, nach oben gibt es bekanntlich keine Grenzen, demonstriert Jeff Bezos, aus dem Weltraum auf uns herabblickend. Für gewöhnliche Menschen aber sind die Grenzen der Selbstoptimierung sehr wohl abgesteckt. Das Paradoxe, und damit Ideologische: Der Neoliberalismus, der die Selbstoptimierung überhaupt erst vorschreibt, verunmöglicht sie.
Selbstoptimierung als neoliberale Landnahme
Jedes Jahr in einer edgy Attitüde zu monieren, der 1. Januar sei eine willkürlich gesetzte Schwelle, mag sich zwar nach verflachter Systemkritik und Spielverderberei anhören für alljene, die an Silvester einfach nur das Jahr nett ausklingen lassen und im Januar ein bisschen mehr Sport machen wollen. Nach einem deprimierenden Jahr kann eine nette Feier mit den Liebsten zumindest ein Pflaster auf die klaffende Wunde legen und in all der Verzweiflung über die Lage der Welt kann die neu gefundene Motivation ein Gefühl von Kontrolle, zumindest im Privatleben, zurückgeben. Vollkommen Unrecht haben Contrarians und Edgelords, die die Konstruiertheit alles Sozialen gerade erst entdeckt haben, aber leider nicht.
Auch Antonio Gramsci hasste Neujahr: »Deshalb hasse ich diese Jahreswechsel mit unverrückbarer Fälligkeit, die aus dem Leben und dem menschlichen Geist ein kommerzielles Unternehmen mit seinem braven Jahresabschluss, seiner Bilanz und seinem Budget für die neue Geschäftsführung machen.« In dieser Analogie, mit dem Menschen als kapitalistischem Unternehmen, symbolisieren die Neujahrsvorsätze die Wachstumsziele des Betriebs. Das Leben wird in Einjahreszyklen gedacht und es zählt am Ende nur der Stichtag am 31.12. Gab es Wachstum oder nicht?
Die Ideologie der Selbstoptimierung folgt auch dem kapitalistischen Zwang in Betrieben, die Produktivität zu steigern: Jahr für Jahr optimieren die Arbeitnehmenden nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihr Berufsleben – insbesondere zugunsten derer, die als Arbeitgeber davon übermäßig profitieren. Nicht nur ist das eine »neue Landnahme«, wie der Soziologe Klaus Dörre es beschreibt, mit der der Kapitalismus aufgrund seines inhärenten Zwangs zur Expansion über immer neue Territorien hinaus auch Lebensbereiche vereinnahmt. Das Land, das eingenommen wird, sind unsere Köpfe und unsere Körper, und der Mechanismus ist die Selbstgängelung. Längst ist die Stimme, die einem »Wachstum, Wachstum, Wachstum« zuflüstert, zu unser aller innerer Stimme geworden. Louis Althusser kennzeichnete hierin die Totalität des Systems: Die kapitalistische Produktionsweise strukturiert nicht nur die Arbeit in den Produktionshallen und Büros, sondern ruft auch ideologisch das Subjekt an und nimmt dessen Gedanken, die Freizeit, die Freundschaften ein.
Plattformökonomische Zurichtung
Einst genügten beruflicher Erfolg und materieller Wohlstand, um von seinen Mitmenschen die Anerkennung zu erhalten, die in einer idealen Welt jeder und jedem zustehen sollte. Schön waren die Zeiten natürlich auch nicht. Doch immer seltener reichen explizite Darstellungen des Reichtums in der Klassengesellschaft aus, sie mögen in manchen Kreisen gar als schäbig wahrgenommen werden. Anerkannt wird das moderne Individuum, das seine eigene Strebsamkeit, sein körperliches und geistiges Wohlbefinden symbolisch im Digitalen auf die gesellschaftlich anerkannte Art und Weise inszeniert, und sein eigenes Wohlergehen, oder zumindest das, wonach es den Anschein hat, dabei selbst konsumiert und von der Öffentlichkeit konsumieren lässt.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login