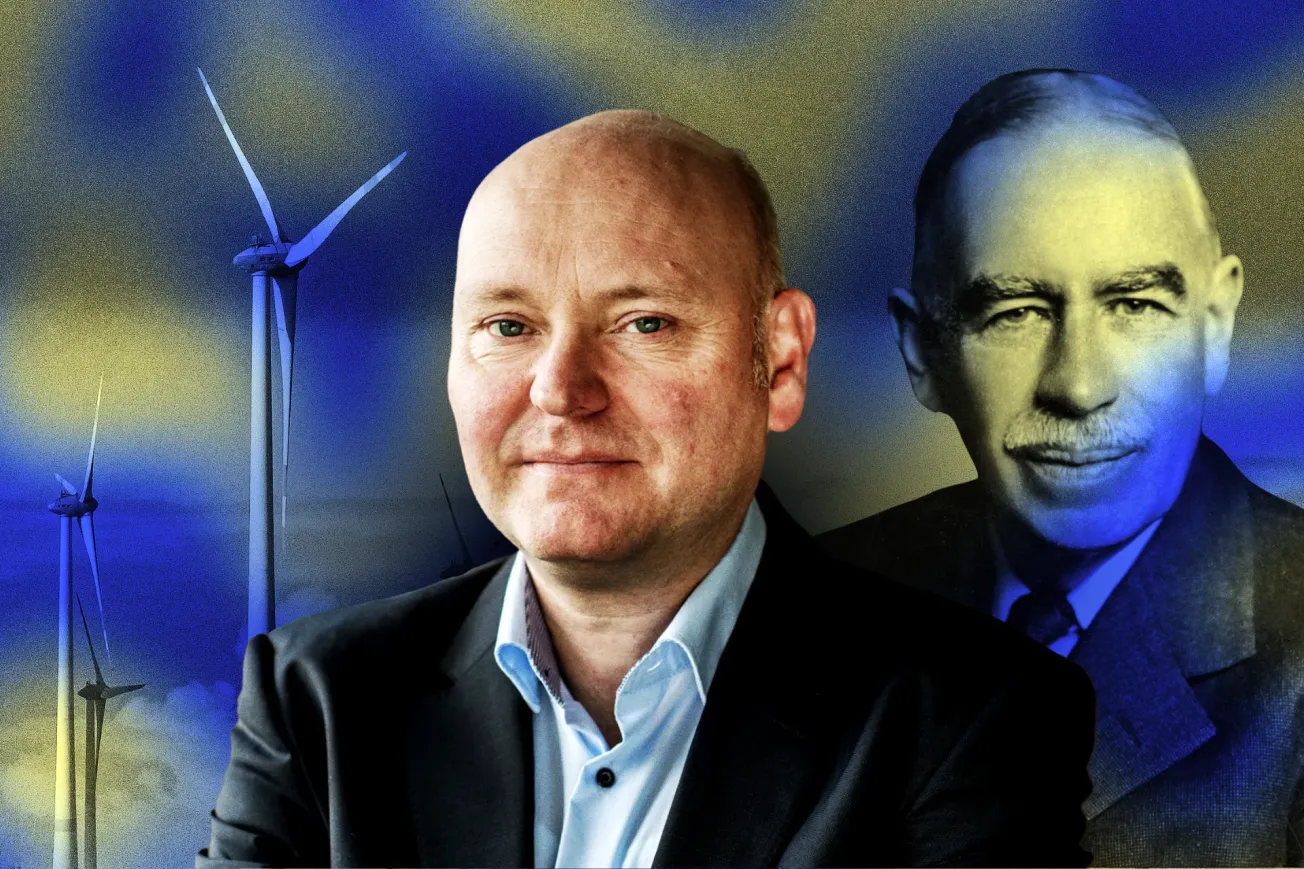Eigentlich ist es vollkommen klar und auch scheinbar Konsens unter Ökonomen: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf ist kein guter Indikator für den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand. Es erfasst nur, was auf Märkten gehandelt wird, und vernachlässigt damit beispielsweise wesentliche Teile der Care-Ökonomie, ohne die menschliche Gesellschaften nicht in Würde existieren könnten. Es leidet unter Bewertungs- und Erfassungsproblemen und ist zudem völlig verteilungsblind: Wenn in einer Gesellschaft mit einem Milliardär und einer Million Bettlern, die nichts haben, der Milliardär eine zusätzliche Milliarde bekommt, verdoppelt sich der als BIP pro Kopf gemessene »Wohlstand« von 1.000 Euro auf 2.000 Euro. Außerdem vernachlässigt es ökologische und klimapolitische Nebenwirkungen der Wirtschaftstätigkeit und Umweltkatastrophen. Das BIP ignoriert auch den Zeitwohlstand: Wenn sich viele Menschen freiwillig für mehr Freizeit statt Einkommen entscheiden, steigt der gesellschaftliche Wohlstand, obwohl das BIP sinkt. Das ist sogar aus einer streng wirtschaftsliberalen Perspektive nicht zu beanstanden, auch wenn Ex-FDP-Chef und -Finanzminister Christian Lindner es nicht verstanden hatte, als er im April 2024 in der NZZ in zutiefst illiberaler Manier den weit verbreiteten Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung bemängelte und stattdessen einen Mentalitätswandel und eine neue »Kultur der Leistungsbereitschaft« forderte.
Innerökonomische Kritik
Vielen Ökonomen fällt es dennoch leicht, Kritik an ihrer Zunft wegen des engen BIP-Konzeptes zurückzuweisen. Es lässt sich nämlich schnell darauf verweisen, dass die genannten Probleme des BIPs ausführlich in den entsprechenden Lehrbuchkapiteln behandelt werden. Zudem gibt es mittlerweile viele Ansätze in der ökonomischen Literatur, in denen Indikatoren für eine umfassende oder ganzheitliche Wohlstandsberichterstattung vorgeschlagen werden. So kann zum Beispiel der Sachverständigenrat Wirtschaft (SVR) mit Recht darauf verweisen, dass er bereits 2010 im Auftrag des deutsch-französischen Ministerrates gemeinsam mit seinem französischen Pendant, dem Conseil d’Analyse Économique (CAE), die ausführliche Studie »Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit: Ein umfassendes Indikatorensystem« vorgelegt hat. Im Jahr 2019 hat er dann anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls ein Update der Indikatorwerte für Deutschland mit dem Titel »Ganzheitliche Wohlfahrtsberichterstattung: Die Entwicklung Deutschlands seit dem Mauerfall« publiziert.
Erklärtes Ziel dieser Publikationen ist es, einen ganzheitlicheren Blick auf den Wohlstand zu ermöglichen. Dazu kommen insgesamt 24 Indikatoren, die den Bereichen materieller Wohlstand, Lebensqualität und Nachhaltigkeit zugeordnet sind, zum Einsatz. Viele davon gehen tatsächlich weit über das BIP hinaus. Um die tatsächliche materielle Versorgung der Bevölkerung zu erfassen, werden zusätzlich die privaten und öffentlichen Konsumausgaben pro Kopf betrachtet und auch die Einkommensverteilung wird in den Blick genommen. Im Bereich Lebensqualität finden sich Indikatoren zum Stand von Gesundheit und Bildung, zur Qualität der Arbeit und zur Erfüllung von Arbeitszeitpräferenzen mittels der Quote der unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigung. Außerdem wurden Indikatoren für die Möglichkeit der politischen Einflussnahme und Kontrolle, für soziale Kontakte und Beziehungen, die Umweltbedingungen sowie die Armutsrisikoquote einbezogen. Schließlich gibt es Indikatoren für die ökologische Nachhaltigkeit (Treibhausgasemissionen, Biodiversität). Man mag bei dem einen oder anderen Indikator Zweifel haben und sich vielleicht einen anderen oder noch breiteren Blick wünschen, aber das BIP als Wohlstandsindikator lässt das Indikatorensystem jedenfalls weit hinter sich.
Die Kritik erreicht die Politik nicht
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login