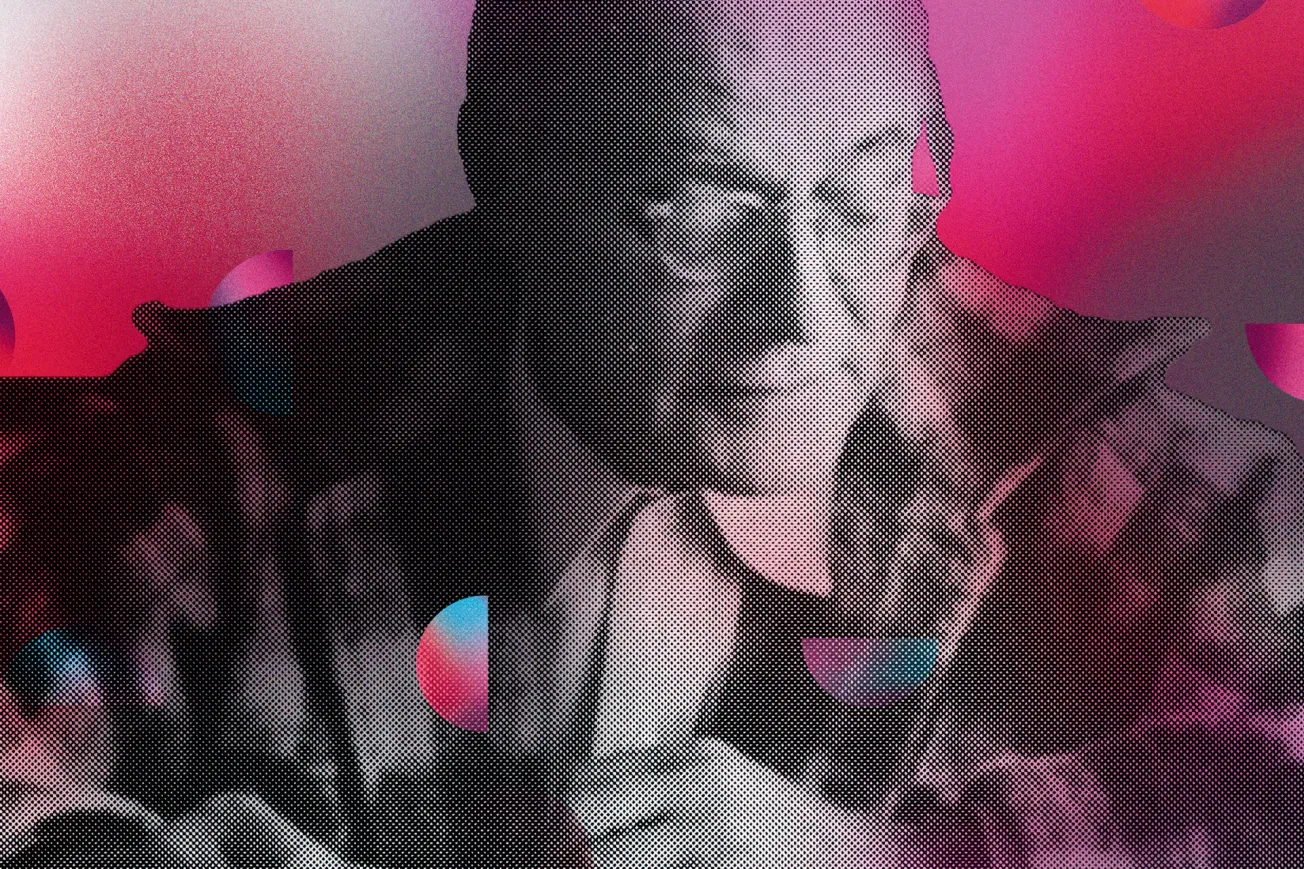Karl Polanyi ist ein Pionier der interdisziplinären Wirtschaftswissenschaft. Mit seinem weiten Verständnis von Ökonomie als der Organisation der Lebensgrundlagen kritisierte er den illusionären Versuch der Wirtschaftsliberalen, alle Lebensbereiche zu vermarktlichen. Karl Polanyi wandte sich gegen jede Form von Dogmatik, allen voran der des wirtschaftsliberalen Marktfundamentalismus. Wiewohl ein Linker, kombinierte er progressives und konservatives Denken, um den Wirtschaftsliberalismus als eine illusionäre und deshalb gefährliche Ideologie zu entlarven. Polanyi zählt zu den wenigen linken Denkerinnen und Denkern, die schon früh die Ambivalenzen gesellschaftlichen Fortschritts erkannten und wussten, wie wichtig »Beheimatung« (habitation) gerade in Zeiten des Umbruchs ist. Deshalb hilft seine Analyse, um aktuelle Dynamiken wie die Klimakrise und den Aufstieg reaktionärer rechter Bewegungen besser zu verstehen.
Karl Polanyi wurde 1886 in Wien geboren, als Kind einer gutbürgerlichen jüdischen Familie. Der ungarisch-österreichische Intellektuelle wuchs in Budapest auf und diente im Ersten Weltkrieg, wo er schwer verletzt wurde. Während des Roten Wien (1919–1934) verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Journalist. 1933 floh er vor dem aufkommenden Austrofaschismus nach England, wo er in der Arbeiterbildung tätig war, um schließlich 1944 in den USA sein Hauptwerk The Great Transformation zu verfassen. Er wurde dort an der Columbia University Professor und wandte sich bis zur Pensionierung der Anthropologie zu, um real existierende alternative Wirtschaftsformen zu studieren, die keine Marktwirtschaften waren. Da seine Frau Ilona Duczyńska als ehemalige Kommunistin kein Visum für die USA bekam, siedelten sie sich in Kanada an, wo er 1964 starb.
Polanyi stand sowohl der Sozialdemokratie als auch dem Bolschewismus, der Freiheit und Demokratie untergrub, kritisch gegenüber. Er bewunderte das sozialdemokratische Rote Wien der Zwischenkriegszeit – neben dem Wohnbauprogramm begeisterte ihn vor allem die Idee, aus Arbeiterinnen und Arbeitern selbstbewusste Menschen zu machen, die die Stadt gestalten. Gleichzeitig störte ihn vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg die Verwaltung des Wohlfahrtskapitalismus. Stattdessen sympathisierte er mit einem christlichen und einem demokratischen Sozialismus. Heute stünde er als radikaler Reformer, als moralischer Realist vermutlich ökosozialistischen Ansätzen nahe.
Keine Märkte ohne gesellschaftliche Einbettung
The Great Transformation erschien 1944 und wollte sich in die Debatten über die Nachkriegsordnung einmischen. Allzu rasch beendete der beginnende Kalte Krieg allerdings die Hoffnung, das Resultat der Verwerfungen von Weltwirtschaftskrise, Faschismus und Krieg werde eine postkapitalistische Gesellschaft sein. Statt alle Lebensbereiche als Marktwirtschaft zu organisieren, sollten in einer gemischten Wirtschaftsordnung die vier sozioökonomischen Prinzipien kombiniert werden: Tausch, dort, wo es sinnvoll ist, Umverteilung durch eine staatliche Zentralmacht zur Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts, Reziprozität als auf Gegenseitigkeit beruhender Zusammenarbeit in Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis sowie Haushalten als das Wirtschaften im eigenen Haus.
Erst nach Polanyis Tod erwachte wieder Interesse an ihm und seinem Hauptwerk: zuerst in der im Gefolge der 1968er-Bewegung aufkommenden Suche nach »alternativen Ökonomien«, dann mit der Kritik am Neoliberalismus und seiner Tendenz zur Ökonomisierung aller Lebensbereiche, inklusive Privatisierung von Bildung, Gesundheit, Wasser und Energie. Nicht alles könne und solle, so Polanyis Kritik, zur Ware gemacht werden. Es gibt auch »fiktive Waren« wie Arbeit, Geld und Land, die nicht für den Markt produziert wurden, weshalb ihre Vermarktlichung den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Seine bekannte zentrale These lautete: Es sei eine wirtschaftsliberale Illusion, Gesellschaft von einem sich selbst regulierenden Markt steuern zu lassen. So eine Gesellschaft könne nicht von Bestand sein. Polanyi identifizierte, dass sich gegen die Bewegung hin zur Vermarktlichung von allem und jedem schon im 19. Jahrhundert Gegenbewegungen bildeten: zivilgesellschaftlich in Form von Gewerkschaften und Genossenschaften, staatlich in Form von Sozial- und Arbeitsgesetzen. In den 1930er Jahren waren Kommunismus (Stalin), Faschismus (Hitler) und Reformpolitik (Roosevelt) unterschiedliche Antworten auf das Versagen des Wirtschaftsliberalismus.
Ende des 20. Jahrhunderts bildete sich erneut eine Bewegung gegen den Wirtschaftsliberalismus, diesmal in Gestalt der neoliberalen Globalisierung. In der Großen Finanzkrise 2008 konnte der Zusammenbruch des Finanzsystems nur durch staatliche Intervention verhindert werden. Damit erhielt die Forderung nach dem Ende des Marktfundamentalismus neuen Auftrieb.
Karl Polanyi kann keiner wissenschaftlichen Disziplin zugeordnet werden. Gemeinhin gilt er als Wirtschaftshistoriker. Tatsächlich inspirierte er die Analysen langfristiger Entwicklungen von Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein und Giovanni Arrighi. Bekannt geworden ist er in der Wirtschaftssoziologie durch das Konzept der Einbettung: Zu meinen, Märkte könnten sich selbst regulieren, sei eine Illusion. Laissez-faire ist unmöglich, denn Märkte sind immer in Institutionen eingebettet. Auch eine wirtschaftsliberale Ordnung braucht die Institutionen Privateigentum und Vertragsrecht. Im Kapitalismus jedoch sind Märkte auf eine bestimmte Weise doch entbettet, insofern sie befreit sind von sozialen Verpflichtungen und demokratischer Kontrolle.