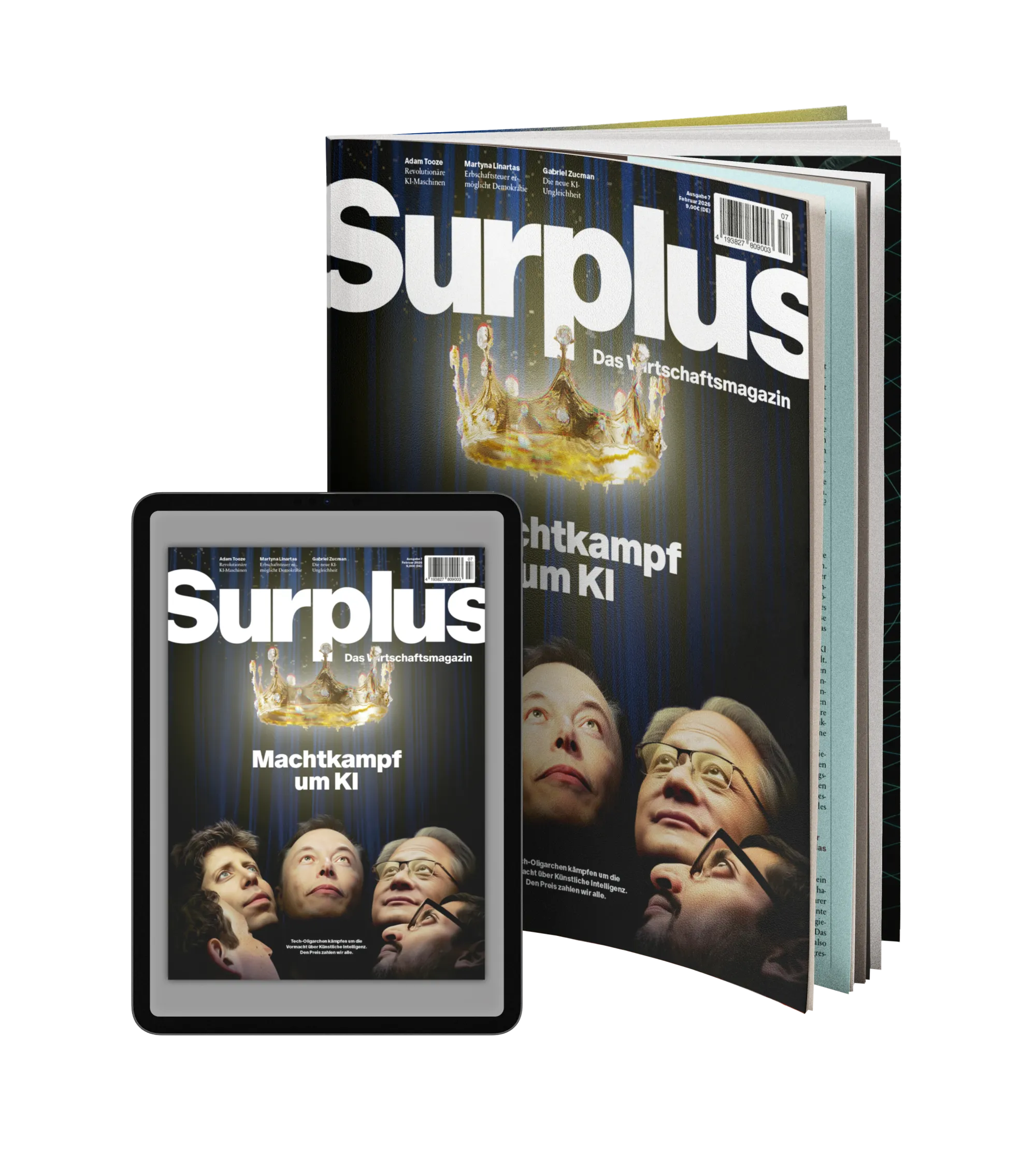Der Politökonom Michael A. McCarthy entwirft die Vision eines Finanzsystems, das demokratisch kontrolliert wird. Er zeichnet nach, wie aus gewerkschaftlichen Rentenfonds renditegetriebene Vermögenspools wurden – und weshalb ETFs und Krypto keine Demokratisierung bedeuten.
Maxine Fowé: Herr McCarthy, warum ist unser heutiges Finanzsystem undemokratisch?
Michael A. McCarthy: Riesige Finanzvermögen, die technisch gesehen den Arbeitenden gehören, werden von großen Vermögensverwaltern kontrolliert und verwaltet – und zwar auf eine Weise, die der Arbeiterschaft insgesamt schadet.
Unsere bestehende verfassungsrechtliche Ordnung trennt den politischen vom ökonomischen Bereich des Lebens und isoliert die Ökonomie von demokratischer Kontrolle. Stattdessen sollten wir uns für eine partizipative Gesellschaft einsetzen, in der der Begriff »politisch« auf Bereiche außerhalb der nationalen Regierungsführung ausgeweitet wird. Dazu gehört dann auch die Frage, wie Finanz- und Kreditströme gelenkt werden.
Ist das Finanzsystem aus ihrer Sicht undemokratischer geworden durch Kryptowährungen und ETFs, in die viele Menschen einfach per App investieren?
Für manche bedeutet Demokratisierung schlicht ein breiterer Zugang zu Assets, die Wohlstand generieren. Ähnliche Überlegungen finden sich auch in der Krypto-Szene: Demokratie ist demnach dezentralisierter Zugang, losgelöst von Bank- und Währungssystemen, die an Staaten gebunden sind. Aber Demokratie ist nicht nur Zugang, sondern vielmehr Entscheidungsgewalt, die auf einer Kombination aus kollektiver Kontrolle und aktiver Willensbildung basiert. Um das zu erreichen, müssen wir uns auf Kontrolle und Verteilung konzentrieren – also darauf, wie Assets verwaltet werden – und nicht nur auf den reinen Zugang und Eigentum.
Die deutsche Bundesregierung plant gerade eine sogenannte Frühstart-Rente, wodurch Heranwachsende in ETFs investieren sollen, um die »Aktienkultur« und Vermögensbildung in der Bevölkerung zu fördern. Wie blicken Sie darauf?
2003 hatte auch George W. Bush das Ziel seiner Präsidentschaft als eine »Eigentümergesellschaft« bezeichnet. In ähnlicher Weise hatte Margaret Thatchers Abbau des sozialen Wohnungsbaus durch Privatisierung das gleiche Ergebnis, nämlich dass Arbeiterinnen und Arbeiter zu Eigentümern wurden. Eigentum ohne Kontrolle gibt den Arbeitnehmern aber nicht die Möglichkeit zu entscheiden, zu welchem Zweck ihr Vermögen angesammelt und verwaltet wird – und wie sich dies wiederum auf ihr eigenes Umfeld auswirkt.
Mit dem Neoliberalismus sind Investitionen in die Realwirtschaft zurückgegangen, während kurzfristige Finanzspekulationen boomen. Wo liegen die Ursprünge dieser Finanzialisierung?
Meiner Ansicht nach hat die Finanzialisierung ihre Ursprünge im Zuge des New Deal in den 1930er Jahren. Zu dieser Zeit wurden Gewerkschaften und Armen-Bewegungen immer stärker. Sie übten erfolgreich Druck auf den Staat aus, sodass groß angelegte Programme eingeführt wurden, beispielsweise die Sozialversicherung in den USA im Jahr 1935. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten sich die Gewerkschaften für eine Ausweitung dieser Sozialversicherung und eine allgemeine Krankenversicherung ein. Damals standen also handfeste sozialdemokratische Programme zur Debatte.
Doch es kam anders.
Stattdessen wandelte sich die politische Ökonomie der USA aber hin zu einer Privatisierung der Sozialleistungen, die durch Tarifverhandlungen ausgehandelt worden waren – wie beispielsweise Gesundheitsversorgung und Renten. Viele Gewerkschaften gingen davon aus, dass die Unternehmen durch die Verpflichtung zu Tarifverhandlungen dazu gebracht werden könnten, staatliche Versorgungsprogramme zu unterstützen, um somit eigene Kosten zu umgehen. Doch die Unternehmen entschieden sich anders, nahmen lieber höhere Geschäftskosten in Kauf, als einen vermeintlichen schleichenden Sozialismus zu unterstützen.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg Pensionsfonds eingerichtet wurden, wurde schnell klar, dass diese massiv anwachsen würden. Arbeitgebende und der Staat verhinderten erfolgreich, dass Gewerkschaften die Kontrolle über diese Fonds erhielten, und verwalteten sie fortan ausschließlich mit dem Ziel, die Renditen zu maximieren.
Mitte der 1970er Jahre kontrollierten diese Fonds etwa 25 Prozent des Unternehmenskapitals in den USA. Dabei glichen ihre Praktiken zunehmend denen der Wall Street: Sie gingen Risiken ein, um Profite zu erzielen, verursachten makroökonomische Instabilität, schwankende Renditen und lenkten Investitionen von gesellschaftlich sinnvollen Gütern weg.

Dadurch entstanden riesige Kapitalpools, die heute von Vermögensverwaltern wie BlackRock gemanagt werden.
BlackRock und Co. sind darauf ausgerichtet, die eigenen Renditen zu maximieren, Deshalb folgen sie einer Logik des Aneignens und Ausbeutens. Ihr Ziel ist es nicht, gute Arbeitsplätze, Güter und kritische Infrastrukturen zu schaffen und zu fördern, die für ein soziales und ökologisches Leben notwendig sind. Indem diese Vermögenspools immer mehr in Finanzinvestitionen fließen, hindern sie Investitionen in Dinge, die zwar gesellschaftlich nützlich, aber eben weniger gewinnbringend sind.