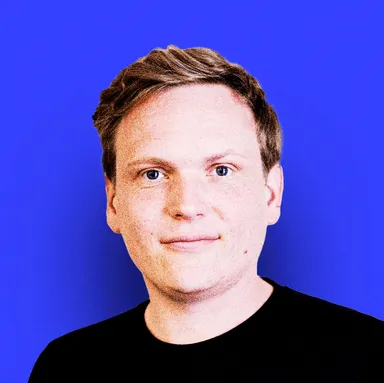Unmittelbar nach der jüngsten Bundestagswahl stellte Friedrich Merz fest, die USA seien »nicht mehr das Amerika, das wir früher kannten«. Für ein Land, dessen Wirtschaftsmodell lange Zeit auf transatlantischen Bündnissen und einem strukturellen Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten beruhte, markiert diese Einschätzung eine tiefgreifende Zäsur in der globalen politischen Ökonomie. Als Reaktion darauf hat sich die Bundesregierung bereit erklärt, ihre nationalen Fiskalregeln zu reformieren – mit dem Ziel, mehr öffentliche Investitionen in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur zu ermöglichen.
Dieser Wandel enthält jedoch einen grundlegenden Widerspruch: Während die Bundesregierung Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur befürwortet, hält sie gleichzeitig an Austerität und Deregulierung fest – etwa durch Kürzungen bei den Sozialausgaben und die Forderung zur Abschaffung der Lieferkettenrichtlinie. Das wird die wirtschaftliche Unzufriedenheit verschärfen. Deutschland braucht dagegen einen nationalen Erneuerungsplan, der das Wirtschaftsmodell grundlegend an die veränderten Bedingungen der globalen politischen Ökonomie anpasst, dem Aufstieg der extremen Rechten entgegenwirkt und den sozialen Zusammenhalt stärkt. Doch ein solcher Plan kann nur dann wirksam sein, wenn er in einen zukunftsfähigen europäischen industriepolitischen Rahmen eingebettet ist.
Die derzeitige Industriepolitik der EU – mit ihrem Fokus auf Resilienz des Binnenmarkts, strategische Autonomie und wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit – ist jedoch von Widersprüchen geprägt. Anstatt den tiefgreifenden Wandel zu ermöglichen, den Deutschland und Europa dringend benötigen, droht sie, genau jene Krisen zu verschärfen, die sie eigentlich bewältigen soll.
Keine Resilienz ohne eine starke Alltagsökonomie
Die Industriestrategie der EU zielt darauf ab, die Resilienz des europäischen Binnenmarkts zu stärken – vernachlässigt dabei jedoch die gezielte Förderung alltagsökonomischer Wirtschaftsbereiche wie des Gesundheitswesens, der Pflege, der Wohnraumbereitstellung, des öffentlichen Nahverkehrs und der kommunalen Daseinsvorsorge. Doch gesellschaftliche Resilienz – also die Fähigkeit, Krisen zu überstehen und sich davon zu erholen – und in der Folge auch die Stabilität der Märkte beruhen auf genau diesen grundlegenden Diensten. Sie bilden das Rückgrat des täglichen Lebens: Rund 40 Prozent der europäischen Arbeitskräfte sind in den alltagsökonomischen Sektoren beschäftigt, und ein erheblicher Teil der privaten Konsumausgaben fließt in sie. Dennoch bleiben sie oft chronisch unterfinanziert, prekär organisiert und anfällig für Marktschwankungen.
Daher braucht es systematische Maßnahmen zur Stärkung dieser Sektoren, etwa durch öffentliche Investitionen, gemeinwohlorientiertes Eigentum, Dekommodifizierung sowie bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Andernfalls drohen sich politische Gegenreaktionen weiter zu verschärfen, was sowohl den gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch die (markt-)wirtschaftliche Resilienz untergräbt. Die derzeitigen Diskussionen über die Finanzierung der europäischen Verteidigungskapazitäten – etwa über Ausnahmen vom EU-Wettbewerbsrecht oder zusätzlichen fiskalischen Spielraum, einschließlich gemeinsamer europäischer Kreditaufnahme – sollten auf grüne und alltagsökonomische Sektoren ausgeweitet werden. Denn ohne eine robuste Alltagsökonomie bleibt die von Europa angestrebte Widerstandsfähigkeit eine Illusion.