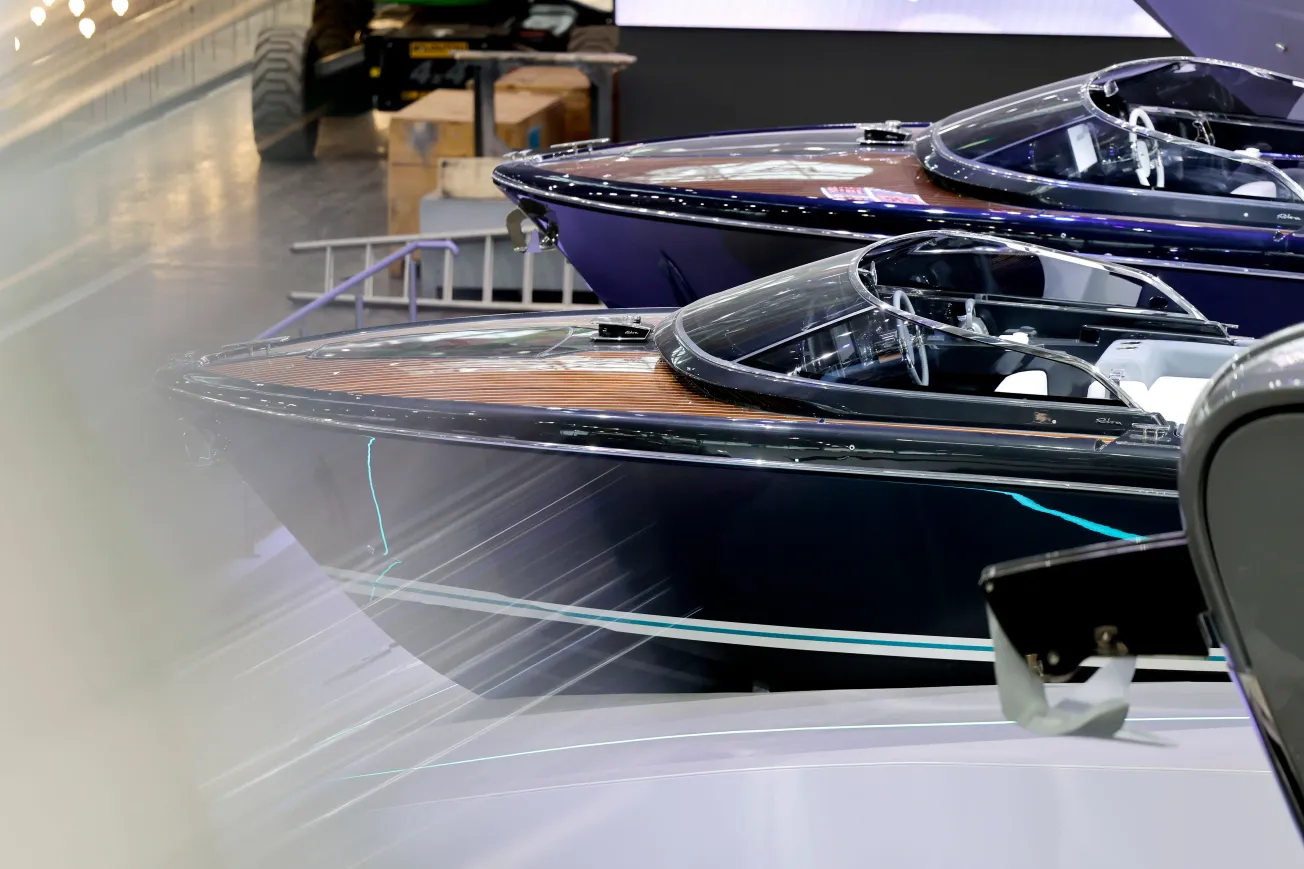Es ist Anfang der Achtzigerjahre. Die sozial-liberale Koalition zerbricht wegen eines FDP-Positionspapiers und Helmut Kohl ruft die »geistig-moralische Wende« aus. Die Band Geier Sturzflug darf erst nach dem Wahlkampf ihren Debüthit Bruttosozialprodukt aufführen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk Sorge hat, dass ihm das sonst als verdeckte CDU-Unterstützung ausgelegt werden könnte. Für den damaligen Jurastudenten und »Jungen-Unionler« Friedrich Merz muss das eine prägende Zeit gewesen sein: »Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt!« Das wäre eine mögliche Erklärung für seine seltsame Fixierung, das Volkseinkommen mit mehr Arbeit statt mehr Produktivität mehren zu wollen. Auch für den Rest der CDU gilt inzwischen: »Work harder, not smarter«.
Polemik beiseite: Die schwarz-rote Koalition unter Merz hat sich vorgenommen, das Arbeitsvolumen auszuweiten. Das soll neben der Aufweichung der täglichen Höchstarbeitszeit auch über eine Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen und -prämien angestoßen werden. Vieles spricht gegen solche Maßnahmen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten ohnehin über eine Milliarde Überstunden pro Jahr – 28 Stunden pro Kopf – von denen 53 Prozent unbezahlt sind. Die steuerlichen Anreize könnten das Modell des männlichen Brotverdieners fördern, statt die Geschlechtergerechtigkeit. Frauen – insbesondere Mütter – stecken hierzulande in der »Teilzeitfalle« und würden von dieser Maßnahme kaum profitieren. Außerdem können viele Menschen, vor allem Frauen, gar nicht mehr arbeiten, da sie noch immer stärker belastet sind von der Kindererziehung oder Pflege von Verwandten.
Darüber hinaus ist vollkommen unklar, ob steuerfreie Überstunden überhaupt zu dem von Merz beabsichtigten Ziel führen würden. Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall sein könnte, denn einige Nachbarländer haben bereits das gleiche Experiment gewagt und sind dabei gescheitert – beispielsweise Frankreich. Zwischen 2007 und 2012 gab es dort sogar eine weitergehende Regelung. Damals wurden neben der Streichung der Steuer auf Überstunden auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und -geber (Lohnnebenkosten) auf Überstunden erheblich gekürzt. Das Ziel der Reform war – wie heute von Schwarz-Rot beabsichtigt – mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen und sie zu mehr Wochenstunden zu bewegen. Zwei Jahre nach Ende der Maßnahme wurde sie von den Ökonomen Pierre Cahuc (Sciences Po) und Stéphane Carcillo (OECD/Sciences Po) evaluiert und die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Journal of Labor Economics publiziert.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login