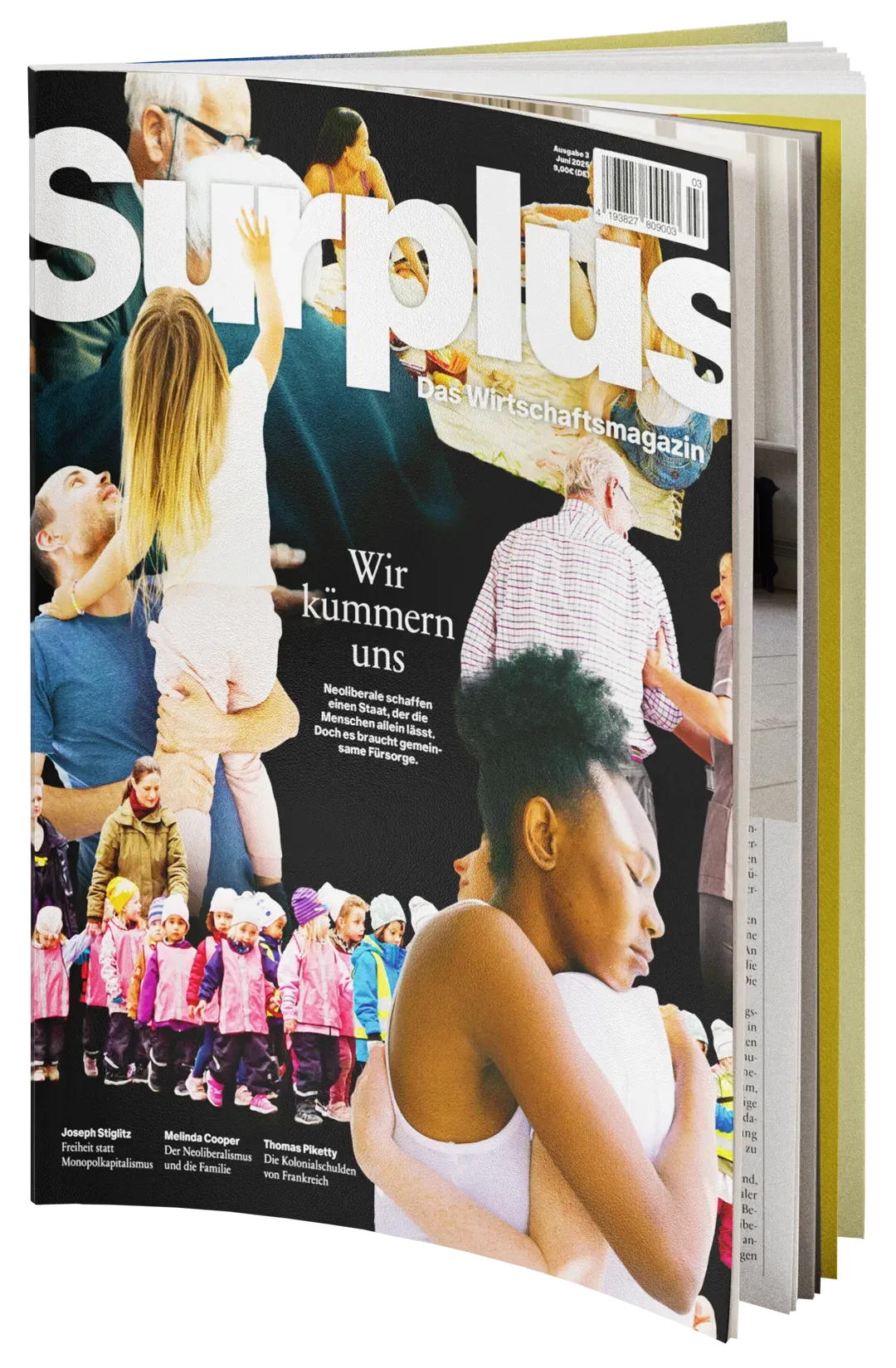Diese Woche gab es »Breaking News« aus Deutschland. Nachrichten, die die globalen Finanzmärkte in Aufruhr versetzten. Nun gut, dazu braucht es nicht viel: Die Märkte sind ohnehin nervös, angesichts der Politik der Trump-Regierung in den USA. Doch dann kam die Nachricht, dass sich CDU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt haben, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern sowie einen 500-Milliarden-Euro-Fonds für Infrastrukturinvestitionen einzurichten. Das ist nicht nur für Deutschland von großer Tragweite.
Insgesamt könnte die Neuverschuldung eine Billion Euro betragen. Das ist eine riesige Summe; doch die Märkte reagierten nicht mit der Panik, die sich bei einigen deutschen Konservativen breit machte. Im Gegenteil: Die Aussicht auf neue deutsche Schulden ist an den Märkten äußerst willkommen. Denn deutsche Staatsanleihen sind normalerweise ein rares Gut. Selbst wenn Deutschland in den kommenden zehn Jahren eine Billion Euro an Schulden aufnehmen sollte, dürfte sich die Schuldenquote des Landes lediglich von 60 auf 85 Prozent erhöhen, was immer noch weit unter dem Durchschnitt der USA oder der Eurozone liegt. Eine Billion Euro an neuen deutschen Schulden bedeutet allerdings, dass den Investoren etwas höhere Zinssätze angeboten werden müssen. Die deutschen Staatsanleihen haben derzeit mit die niedrigsten Zinssätze der Welt. Das treibt Investoren wiederum dazu, in andere europäische Assets wie französische, spanische oder italienische Staatsanleihen zu investieren. Diese sind etwas riskanter – aber sie bringen eine bessere Rendite. Die plötzliche Verfügbarkeit »hochwertiger« deutscher Schuldtitel setzt die Emittenten von derartigen Schuldtiteln mit »geringerer Qualität« in ganz Europa unter Druck. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Aussicht, dass eine deutsche Regierung unter Merz mit der von Ursula von der Leyen geführten EU-Kommission in Brüssel vereinbaren könnte, noch mehr europäische Verteidigungsanleihen auszugeben. All das wären »hochwertige Schuldtitel«, die eifrige Investoren anziehen dürften. Es besteht dabei keine Aussicht auf eine europäische Finanzkrise. Es ist lediglich so, dass die Ausgabe eines so großen Anleihevolumens zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern führen wird. Ein größeres Angebot an Schuldtiteln sehr hoher Qualität wird die Preise nach unten drücken – und wenn das mit dem Preis von Anleihen geschieht, steigt der effektive Zinssatz, die Rendite, und das wird zu einer Umschichtung von Billionen Dollar in globalen Portfolios führen. Auf die vielbeschäftigten Männer und Frauen, die die wirklich großen Anlageportfolios verwalten, kommt also einiges an Arbeit zu.
Alles in allem ist die plötzliche Erkenntnis von CDU und SPD (den Erfindern der deutschen Schuldenbremse im Jahr 2009), dass Deutschland Kredite für Investitionen aufnehmen sollte, ein längst überfälliger Grund zum Feiern. Endlich gibt es Anzeichen dafür, dass Deutschland Europa bei der Suche nach einer angemessenen Antwort auf die aktuellen Herausforderungen tatsächlich anführen könnte: Wie kann nachhaltiges Wachstum generiert und Europas Verteidigung auf eine Grundlage gestellt werden, die nicht auf der ebenso demütigenden wie gefährlichen Abhängigkeit von den USA beruht?
Viele von uns setzen sich seit Jahren für ein Ende der Schuldenbremse und eine expansive europäische Investitionspolitik unter Führung Deutschlands ein. Dieses Ende ist nun endlich in Sicht. Doch jetzt folgt das »Aber«. Wie immer, wenn Wirtschaftspolitik in allgemein-makroökonomischen Begriffen formuliert wird, beginnt die Politik zunächst mit den groben Umrissen der Fiskal- und Geldpolitik. Es ist grundsätzlich gut, dass diese nun in eine expansive Richtung gelenkt werden und die politische Klasse Deutschlands ihre fast schon perversen Zwangsvorstellungen von Schulden überwindet. Aber ebenso ist klar, dass es nun auch ein einfallsreiches Denken in Bezug auf drei Dinge erfordert; erstens, die Nebenwirkungen einer überhitzten Wirtschaft. Zweitens, die grundsätzliche Frage nach der Prioritätensetzung bei den Ausgaben. Drittens gibt es noch dringliche und offensichtliche Fragen zur demokratischen Legitimation dieses Wendepunkts in der wirtschaftspolitischen Geschichte der Bundesrepublik.
Die erste Frage des Strukturwandels sollte mit einer progressiven Vision beantwortet werden. Die Zweite, die der Prioritäten, bedarf einer klaren Ablehnung des aktuellen CDU-SPD-Plans sowie der Forderung nach anderen Investitionsschwerpunkten. Die Dritte, die parteipolitische Dimension des Vorschlags, sollte derweil nicht weniger als ein Skandal sein und einen Aufschrei provozieren. Es ist erschreckend, dass der Vorschlag von CDU und SPD in seiner Form überhaupt in Betracht gezogen wird.
Keine Frage: Die deutsche Wirtschaft kann im Moment zusätzliche Nachfrage gut gebrauchen. Die Reallöhne sind seit der Corona-Pandemie gesunken. Die Industrieproduktion ist eingebrochen. Es besteht die Gefahr einer anhaltenden Rezession. Aber es ist auch wahr, dass die deutsche Gesellschaft empfindlich auf Preisschocks reagiert. Und wenn die Wirtschaft mit einem großen Strom neuer Investitionen angeheizt wird, entsteht Preisdruck. Dies muss politisch gesteuert statt rundheraus abgelehnt werden.
Deutschland braucht einen Strukturwandel. Dieser Strukturwandel ist regional unterschiedlich. Der Druck auf die Lebenshaltungskosten in wachstumsstarken Regionen wird hoch sein. Auf allen Ebenen, in einzelnen Stadtteilen, Städten, Regionen und auf nationaler Ebene, muss eine Debatte darüber geführt werden, wie mit diesen Belastungen umgegangen werden soll. Das sollte von progressiven Kräften als Chance begrüßt werden, um politische Forderungen zu artikulieren und den inhärent politischen Charakter ökonomischer Zusammenhänge offen zu diskutieren.
Insgesamt geht es jedoch im Kern darum, dass sich die deutsche Gesellschaft der Frage stellen muss: Sind wir bereit für ein schnelleres Wachstum und für einen tatsächlichen Strukturwandel? Man kann nicht die Summe von einer Billion Euro investieren und gleichzeitig versprechen, dass schon irgendwie alles beim Alten bleiben wird.
Wenn das Geld ausgegeben wird, werden sich die Dinge in jedem Fall verändern. Die Frage ist, wer diese Veränderung steuert – und in welche Richtung. Neu wird aber nicht nur das Tempo des Wandels sein, sondern auch der Gesamtrahmen. Im Vergleich zu Austeritätsmaßnahmen in Zeiten eines schnelleren Wachstums bleiben die Kompromisse und Zielkonflikte zwar genau dies, sie werden aber durch das Gesamtwachstum abgefedert. Konkret heißt das: Es wird beispielsweise weitere Gentrifizierungs- und Verdrängungseffekte geben; aber mit den neuen Infrastrukturfonds können wir nun auch verlangen, dass es echte soziale Wohnmöglichkeiten für diejenigen gibt, die es sich schlicht nicht mehr leisten können, in den Wachstumszentren zu leben. Genau dieser »Kompromiss« hat damals den außerordentlich dramatischen Strukturwandel der sogenannten Wirtschaftswunderjahre ermöglicht. Wenn wir ernsthaft transformative Investitionen wollen und eine wirklich progressive Wirtschaftspolitik dies erfordert, dann müssen wir uns auf ein neues Zeitalter der Veränderung und des Wandels vorbereiten. Die richtige Politik zu machen bedeutet, sich zu fragen, wer sich bewegt, wer sich verändert, und unter welchen Bedingungen.