Weltweit steigen rechte Parteien auf und übernehmen die Macht. Die liberalen Demokratien befinden sich wahrscheinlich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch in politischen Debatten zeigt sich immer häufiger eine Mischung aus Wut, Abwertung des politischen Gegners und dem Verlangen, »alles niederzureißen«. Doch woher kommt diese destruktive Energie, die immer mehr Menschen nach rechts treibt?
Die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey haben mit Zerstörungslust nun ein Buch vorgelegt, das möglicherweise zu den wichtigsten des Jahres gehört. Sie haben eine Umfrage mit 2600 Personen durchgeführt und durch Interviews mit 41 Teilnehmenden ergänzt. Die Ergebnisse haben sie in einer umfassenden Theorie eines neuen, »demokratischen Faschismus« verarbeitet. Die im Buch vorgestellten Erkenntnisse und Auszüge aus den Interviews mit AfD-Wählenden bieten zahlreiche wichtige Einsichten. Im Ergebnis steht ein Werk, das mit der Intention geschrieben wurde, »den Faschismus effektiver zu analysieren und dadurch auch besser bekämpfen zu können«. Diesem Anspruch werden die Soziologen gerecht.
Im Gegensatz zu vielen anderen Arbeiten, die sich mit dem Aufstieg der Rechten befassen, gehen Amlinger und Nachtwey konsequent von den ökonomischen Strukturen aus, in die unsere Gesellschaft eingebettet ist und von denen sie geprägt wird. Ihre zentrale Aussage lautet: Der gesellschaftliche Auftrieb der Rechten entsteht aus einem Gefühl des Blockiertseins. Menschen empfinden so, schreiben Amlinger und Nachtwey, »weil zentrale Versprechen wie Selbstbestimmung oder Aufstieg durch Leistung nicht mehr eingelöst werden.« Auch Brüche im eigenen Leben und die Angst vor Statusverlust – gespeist aus der Hoffnungslosigkeit, dass die Zukunft nicht besser werden kann als die Vergangenheit – spielen eine wichtige Rolle für die Zerstörungslust über unterschiedliche Klassen hinweg. Aus dem realen oder gefühlten Blockiertsein resultiert das Bedürfnis, die gesellschaftlichen Institutionen niederreißen zu wollen – sei es um der Zerstörung selbst willen oder um aus der Asche eine neue Ordnung hervorgehen zu lassen.
Ursprung der Zerstörungslust: Blockiertsein und neoliberale Strukturen
Die theoretische Fundierung ihrer Analyse steht in einer langen Tradition der Faschismusforschung – von Karl Polanyi bis zur Frankfurter Schule –, die ein Verständnis dafür entwickelten, wie die Unterwerfung der Gesellschaft unter den Markt und Hyperindividualisierung letztendlich zum Zerbrechen gesellschaftlicher Strukturen führen. In diesem Rahmen kann der »demokratische Faschismus« als konsequentes Ergebnis neoliberaler Politik gesehen werden: Der Markt wird strukturell vor demokratischen Eingriffen geschützt, und Politik wird primär zugunsten der oberen Einkommensschichten gestaltet. Die soziale Mobilität nimmt ab, die Qualität der Daseinsvorsorge leidet unter chronischen Unterinvestitionen und Privatisierungen. Demokratie wird entleert, weil sie auf die Gestaltung der Wirtschaftspolitik keinen nennenswerten Einfluss mehr ausüben kann. Die Ohnmacht gegenüber den gesellschaftlichen Strukturen macht Menschen empfänglich für autoritären Populismus. Das Gefühl einer »umfassenden Blockade«, die einen bedeutenden Teil der Gesellschaft daran hindert, ihre gewünschten »Spuren in der Welt [zu] hinterlassen«, führt in Anlehnung an Erich Fromm dazu, dass die »auf das Leben ausgerichtete Energie einen Zerfallsprozess [durchmacht] und sich in Energie [verwandelt], die auf Zerstörung ausgerichtet ist.«
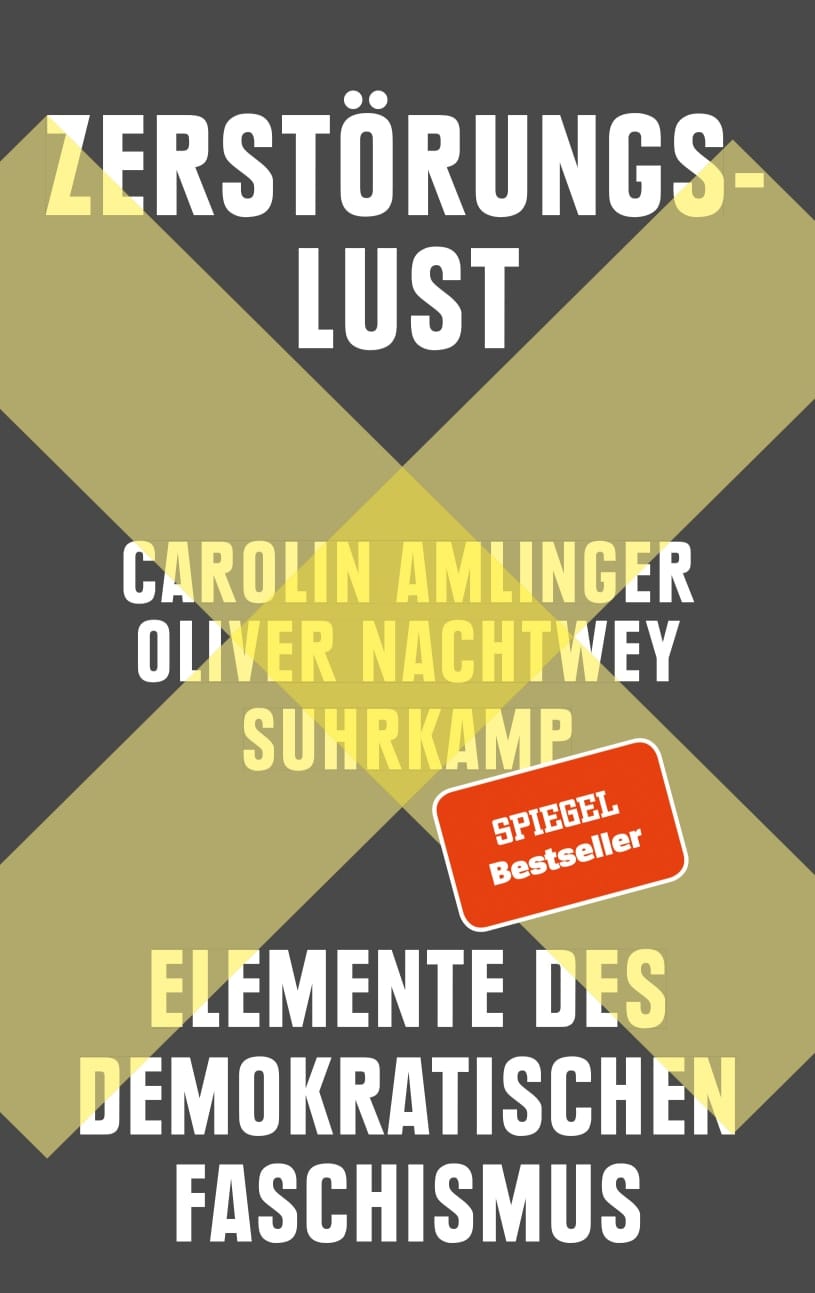
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey: Zerstörungslust
Elemente des demokratischen Faschismus. 3. November 2025, Suhrkamp.







