Wenn die KI trainiert, dann flimmert die Luft vor Hitze. 200.000 Grafikprozessoren verschlingen Daten, Ventilatoren drehen sich und das Kühlwasser rauscht durch die Leitungen. Draußen, vor der Halle, in der das Gehirn von Grok steckt, verbrennt Methangas in mobilen Gasturbinen. Das weltweit größte Rechenzentrum braucht eine enorme Menge Strom, so viel wie hunderttausende Haushalte.
Vor der umgebauten Werkshalle in einem Industriegebiet im Süden von Memphis flattert die schwarz-weiße Flagge von xAI, dem KI-Unternehmen von Elon Musk. Das Gelände ist umzäunt. Von der Straße aus sieht man den vollen Parkplatz und Arbeiter in Warnwesten, die zwischen Baukränen und Kabeltrommeln umherlaufen. Nach nur 122 Tagen Bauzeit ging die Anlage Anfang September 2024 online. Der Chatbot Grok, der in das soziale Netzwerk X integriert ist, trainiert seitdem in Memphis, verschickt Antworten auf Nutzerfragen. Darunter gab es auch rechtsextreme Aussagen, mit denen er zuletzt für Aufsehen sorgte – etwa dass Hitler die richtige Person wäre, um den »abscheulichen Hass auf Weiße zu bewältigen«.
KI verschmutzt die Luft in Memphis
»In Boxtown riecht es jetzt nach Gas«, sagt Alexis Humphreys. Die 28-Jährige sitzt im Vorgarten des Hauses ihrer Großmutter, sie selbst lebt nebenan. Die Nachbarschaft Boxtown liegt gut zweieinhalb Kilometer Luftlinie von dem Rechenzentrum entfernt. Grillenzirpen, kaum Verkehr, kleine Häuser mit großen Gärten. Gefühlt ist das Industriegebiet weit weg. Aber die Menschen, die hier leben, spüren, was die Gasturbinen außer Strom für Grok noch erzeugen: Stickoxide und Formaldehyd – Stoffe, die der Lunge schaden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können und krebserregend sind.
Humphreys ist Schwarz, wie fast alle Bewohner von Boxtown und 95 Prozent der Menschen im Südwesten von Memphis. Knapp ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Der reichste Mann der Welt, glauben viele hier, hat sein Rechenzentrum in ihre Nachbarschaft gebaut, weil sie sich keine teuren Anwälte leisten können. Weil sie es schwerer haben, sich Gehör zu verschaffen, kurzum, weil von ihnen nicht viel Gegenwehr erwartet wurde. Weil die Luft in der Nachbarschaft ohnehin schon verschmutzt sei, wegen der anderen Anlagen, die über die Jahre in ihrer Umgebung gebaut wurden, der Erdölraffinerie, dem städtischen Gaskraftwerk, der Kläranlage.
Humphreys hat rot gefärbte Haare, sie studiert Grafikdesign und verkauft bedruckte T-Shirts. Sie sei eine der Jüngsten in der Nachbarschaft. »Ich liebe es hier«, schwärmt sie. »Es ist so ruhig und friedlich.« Aber sie vermutet auch, dass ihre Heimat sie krank gemacht hat. Humphreys hat Asthma. Nach Jahren ohne Anfälle habe sie vor Kurzem wieder am Boden liegend nach Luft gerungen. »Meine Ärztin meinte, es liegt daran, dass die Luft, die ich atme, schlechter ist als zuvor.« Die Entscheidungsträger der Stadt würden sich nicht um ihre Gemeinschaft kümmern, meint Humphreys. »Geld über Gesundheit – das ist Unsinn. Wenn wir krank sind, können wir mit den 25 Prozent nichts anfangen.« 25 Prozent, das ist der Anteil der xAI-Steuereinnahmen, den Memphis’ Bürgermeister Paul Young dem Südwesten der Stadt versprochen hat. 12 bis 25 Millionen Dollar wird xAI jährlich in Memphis’ Kassen spülen – Geld, das die Stadt dringend braucht. So argumentieren der Bürgermeister und die lokale Handelskammer, die Musk nach Memphis lockte.

Die USA wollen den globalen Wettkampf um die KI-Vormacht gewinnen
Musk hat sein Rechenzentrum Colossus getauft. Um die Konkurrenz, andere KI-Firmen wie OpenAI oder Anthrophic, einzuholen, musste es ein Werk mit gigantischer Rechenleistung sein – in Rekordzeit. Die Menschen vor Ort, darunter auch lokale Politiker, erfuhren erst nach Baubeginn von dem Projekt – aus den Fernsehnachrichten. Die Stadtwerke hatten Geheimhaltungsverträge unterschrieben. Weil sie Musk nicht auf die Schnelle genügend Energie liefern konnten, kamen die mobilen Gasturbinen nach Memphis. 15 sollten es sein, eine Genehmigung, hieß es von Seiten der Stadt, brauche xAI dafür im ersten Jahr nicht. Anfang April veröffentlichte eine NGO Luftaufnahmen des Geländes, auf denen 35 Gasturbinen zu sehen waren. Nur 15 würden auch laufen, beruhigte der Bürgermeister. Die NGO unternahm einen zweiten Flug, diesmal mit Wärmebildkamera: Über 30 Turbinen strahlten rot vor Hitze.
Spätestens seit diesem Zeitpunkt trauen die Menschen in Boxtown den Aussagen von xAI und ihrem Bürgermeister nicht mehr. Sie sind wütend. »Es war ein hinterhältiger Deal!«, schimpft Sarah Gladney. »Wir wurden angelogen, getäuscht, für unwichtig befunden. Wir haben es satt, immer kämpfen zu müssen, nur um saubere Luft atmen zu können.« Gladney ist eine ältere Dame, sie sitzt auf der Veranda ihres Hauses, hinter einer ordentlich gestutzten Hecke. »Meine Augen brennen seit ein paar Wochen. Sie tränen, sie sind verfärbt.« Vor Gladney steht ihre Nachbarin, Merilyn Grooch, die eigentlich nur kurz habe Hallo sagen wollen, wie man das eben so mache in Boxtown, aber auch sie ist empört. »Warum haben sie uns nicht mit einbezogen, warum gab es keine Gespräche?«
xAI hat inzwischen eine Genehmigung vom lokalen Gesundheitsamt für den Betrieb der 15 Gasturbinen erhalten. Sie sollen dem Unternehmen zufolge nur noch als Back-up dienen, sobald ein zweites Umspannwerk fertiggestellt sei und die Anlage mehr Strom als bislang aus dem Netz beziehen könne. Die Turbinen sollen – nach über einem Jahr im Betrieb – mit einer Technologie zur Reduktion von Abgasen ausgestattet werden. Wie stark genau die Turbinen aktuell die Luft in Boxtown verpesten, darüber streiten die Stadt und die Bewohner. Beide machen ihre eigenen Messungen. Elon Musk baut derweil etwa 12 Meilen entfernt bereits ein zweites Rechenzentrum. Colossus 2 soll noch größer werden – insgesamt will Musk in Memphis eine Million Grafikprozessoren zusammenschalten. Die Anlage braucht daher auch noch mehr Strom. xAI hat 66 mobile Gasturbinen gekauft. Das Gas soll dieses Mal aber nicht in Memphis verbrannt werden, sondern einen knappen Kilometer von der Anlage entfernt, südlich der Staatsgrenze, in Mississippi. Laut Musk soll zusätzlich ein neues Gaskraftwerk im Ausland gebaut werden, viel mehr dazu ist aber nicht bekannt.
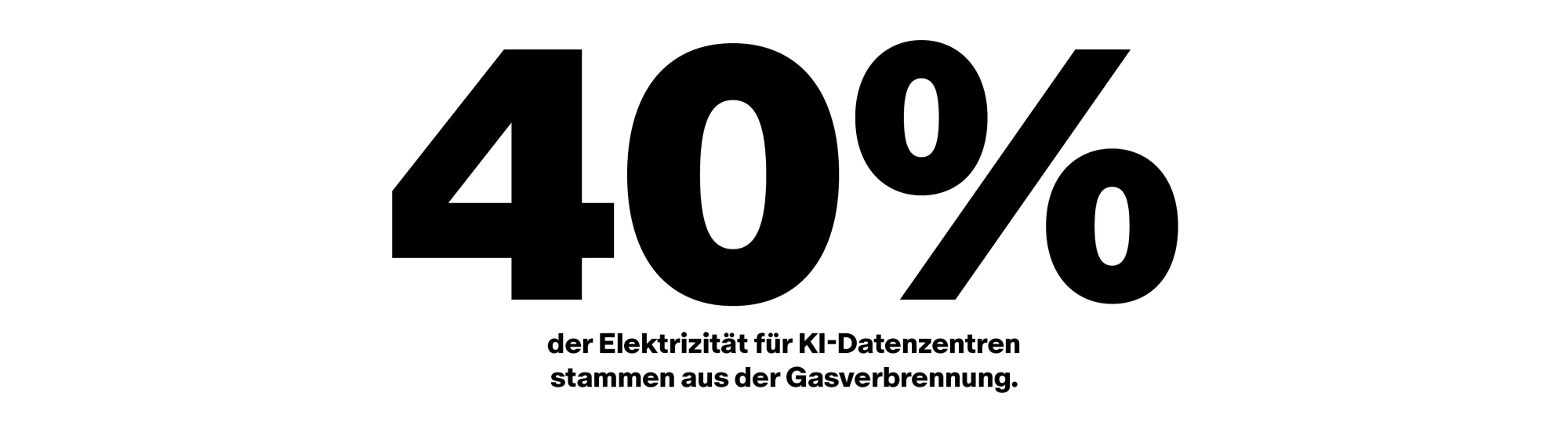
Lange hieß es, Wind und Solar würden die Energie für KI liefern. Zumindest in den USA siegt aber gerade Schnelligkeit über Nachhaltigkeit. Die Technologie, die die Zukunft bestimmen wird, sorgt für die Renaissance eines Energieträgers, der eigentlich bald der Vergangenheit angehören sollte. Nur 24 Prozent der Elektrizität für Datenzentren in den USA kommen aus erneuerbarer Energie, 20 Prozent aus Atomkraft und für über 40 Prozent wird Gas verbrannt. Gaskraftwerke bieten Elektrizität ohne Unterbrechungen, sind schnell einsatzfähig. Außerdem ist Gas in den USA günstig. Und natürlich macht auch das politische Klima fossile Treibstoffe attraktiv. Die USA würden tun, was auch immer nötig sei, um das weltweite KI-Rennen zu gewinnen, sagte Donald Trump bei der Vorstellung seines »AI Action Plan« im Juli.
Gesetze zum Schutz der Luft oder des Klimas sollen dem nicht im Wege stehen. Der von Trump ernannte neue Chef der EPA, der Umweltschutzbehörde, arbeitet daran, möglichst viel Umweltschutz rückgängig zu machen. Dutzende Gesetze zur Luftreinhaltung wurden bereits abgeschafft. Auch die komplette Abteilung für Umweltgerechtigkeit existiert nicht mehr. Dafür hat auch Elon Musk gesorgt, zu seiner Zeit als »Effizienzberater« des Präsidenten.







