Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch »Klassengesellschaft akut. Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann« von der Professorin für Soziologie, Nicole Mayer-Ahuja. Das Buch ist am 18. September 2025 bei C.H. Beck erschienen.
Jenseits des Betriebs sind die Gräben zwischen einheimischen und migrantischen Beschäftigten seit den Anfängen des Kapitalismus in vieler Hinsicht tiefer geworden. Dies hat paradoxerweise nicht zuletzt mit jenen politischen und sozialen Rechten zu tun, durch die Lohnarbeit erst zu einem sozialen Status erhoben wurde. Weil etwa mit der Staatsbürgerschaft inzwischen sehr viel mehr Rechtsansprüche verbunden sind (vom Wahlrecht bis zum Zugang zu sozialen Unterstützungsleistungen), macht es einen erheblich größeren Unterschied als früher, ob es sich bei Menschen mit »Migrationshintergrund« um Kinder ehemaliger Gastarbeiter und -arbeiterinnen handelt, die einen deutschen Pass haben, ob sie selbst migriert sind und ob sie aus einem EU-Mitgliedsland oder aus einem »Drittstaat« stammen.
Hierarchische Strukturen
Gerade in Hinblick auf Prozesse von Klassenformierung lohnt zudem ein genauerer Blick darauf, welchen Beitrag staatliche Migrationspolitik dazu leistet, Unterschiede und Konkurrenz zwischen Beschäftigten zu vergrößern. Zum einen wird die Solidarisierung zwischen einheimischen und migrierten Arbeitenden offenkundig massiv erschwert, wenn (durchaus nicht nur von gesichert rechtsradikalen Parteien) seit Jahrzehnten und aktuell immer lautstarker eine Begrenzung von Migration gefordert wird, die etwa Horst Seehofer (CSU) als »die Mutter aller Probleme« bezeichnet hat. Zum anderen werden die Unterschiede und die Konkurrenz zwischen verschiedenen migrantischen Gruppen durch eine staatliche Politik befeuert, die Migration hochgradig selektiv handhabt: Bestimmten Gruppen von Zuwandernden wird es erleichtert, zu attraktiven Bedingungen in Deutschland zu arbeiten. So lässt sich das staatlich unterstützte Werben um Arbeitskräfte aus dem Ausland etwa in der IT- oder Pflegebranche beobachten, wo es an (hoch-)qualifiziertem Personal mangelt. In jenen Teilen der Arbeitswelt hingegen, in denen vor allem kurzfristig auf un- oder angelernte Arbeitskraft zugegriffen wird, tragen politische Interventionen (oder deren Unterlassung) aktiv dazu bei, Standards von Arbeitsregulierung zu unterlaufen. Das Ergebnis ist eine komplexe Hierarchie: Oben stehen Beschäftigte mit deutschem Pass; darunter folgen migrantische Beschäftigte verschiedener Herkunft, die immer deutlicher als Arbeitende minderen Rechts betrachtet werden müssen, je weiter man nach unten kommt.
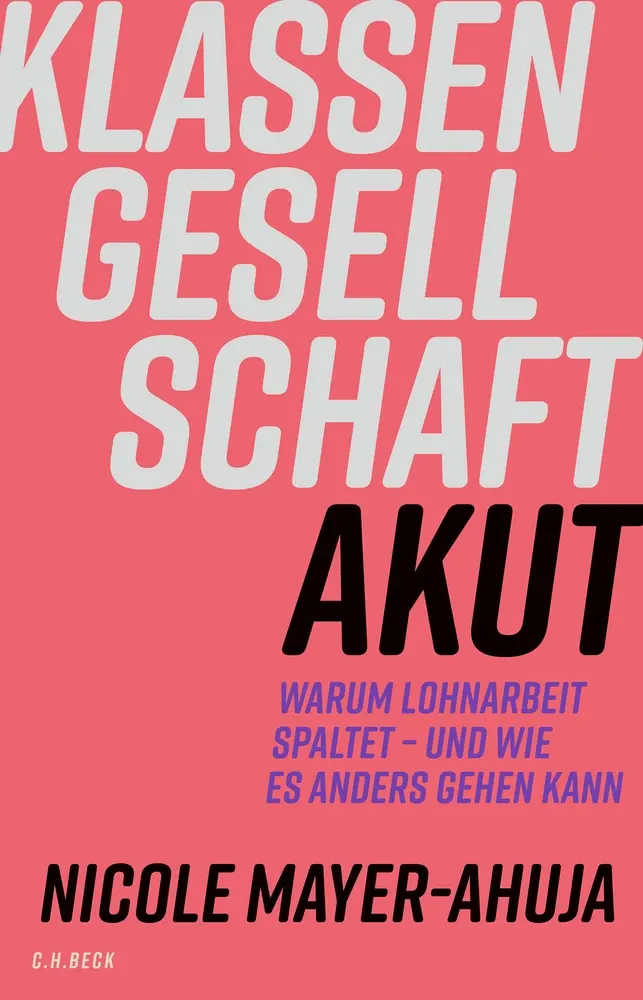
Nicole Mayer-Ahuja: Klassengesellschaft akut
Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann. September 2025, C.H. Beck.
Dies lässt sich etwa in der Fleischindustrie beobachten. Dort arbeiten polnische Beschäftigte zu Bedingungen, die viele Einheimische rundweg ablehnen würden. Weil sie als Angehörige eines EU-Staates jedoch Freizügigkeit genießen, haben sie gegenüber denjenigen, die aus Drittstaaten zuwandern, eine vergleichsweise starke Stellung und üben eher qualifizierte Tätigkeiten aus. Die unattraktivsten Jobs in der Ausstallung und der (nächtlichen) Schlachthofreinigung übernehmen hingegen besonders oft Geflüchtete. Auch ihre (schlechte) Verhandlungsposition ist eine direkte Folge staatlicher Politik. Sie können in Bezug auf Löhne und Arbeitsbedingungen kaum Ansprüche stellen, weil Aufenthaltsrechte (beginnend mit dem »Sommer der Migration« 2015) noch stärker als zuvor an Erwerbsarbeit gekoppelt werden. Geflüchtete werden damit gezwungen, jeden Job anzunehmen, um nicht in Krieg und Elend zurückgeschickt zu werden. Von (auch nur formal) »freier Lohnarbeit« kann hier nicht mehr die Rede sein.
Diese durch staatliche Migrations- und unternehmerische Personalpolitik verschärfte Konkurrenz dürfte ein Grund dafür sein, dass sogar frühere Generationen von Zugewanderten teilweise für geschlossene Grenzen eintreten. Sehen sie doch ihre hart erarbeitete Position in der Gesellschaft durch zunehmenden Rassismus, den Wert ihrer vom Mund abgesparten Eigentumswohnung durch den Zuzug von Geflüchteten in migrantische Stadtteile oder ihren beruflichen Status durch »Billigarbeit« aus dem Ausland bedroht. Weil diese Konkurrenz eben nicht nur im Betrieb und auf dem Arbeitsmarkt spürbar ist, sondern auch beim Zugang zu angemessenem Wohnraum, zu Bildung oder zu Aufenthalts- und Wahlrecht, spricht Birke von einer mehrfachen beziehungsweise »multiplen« Prekarität.
Wie lässt sich Solidarität herstellen?
Für unsere Diskussion über Prozesse von Klassenformierung und speziell über Potenziale der Solidarisierung zwischen Beschäftigten unterschiedlichen Geschlechts beziehungsweise unterschiedlicher Herkunft sind an diesem Punkt vor allem vier Überlegungen festzuhalten.
Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:
Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login







