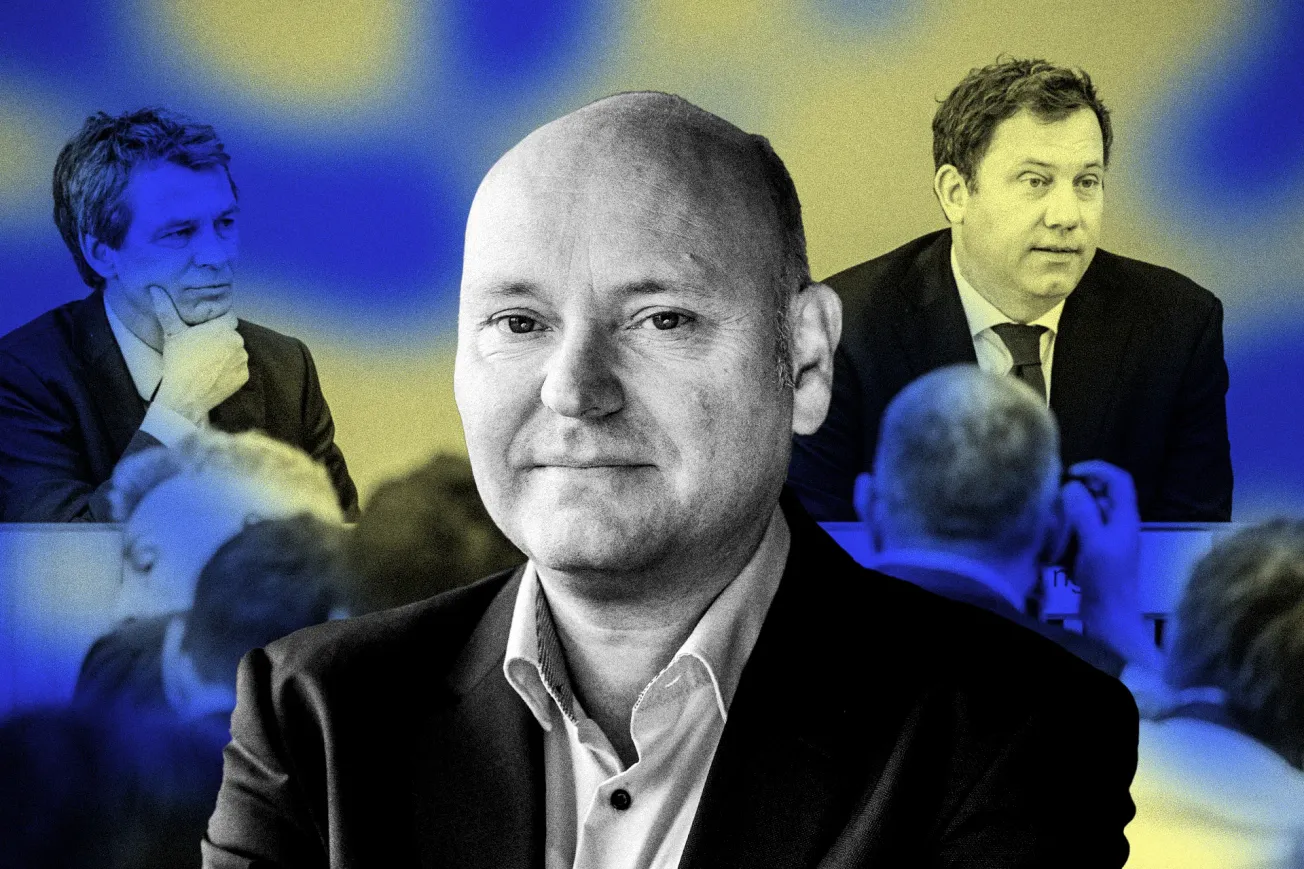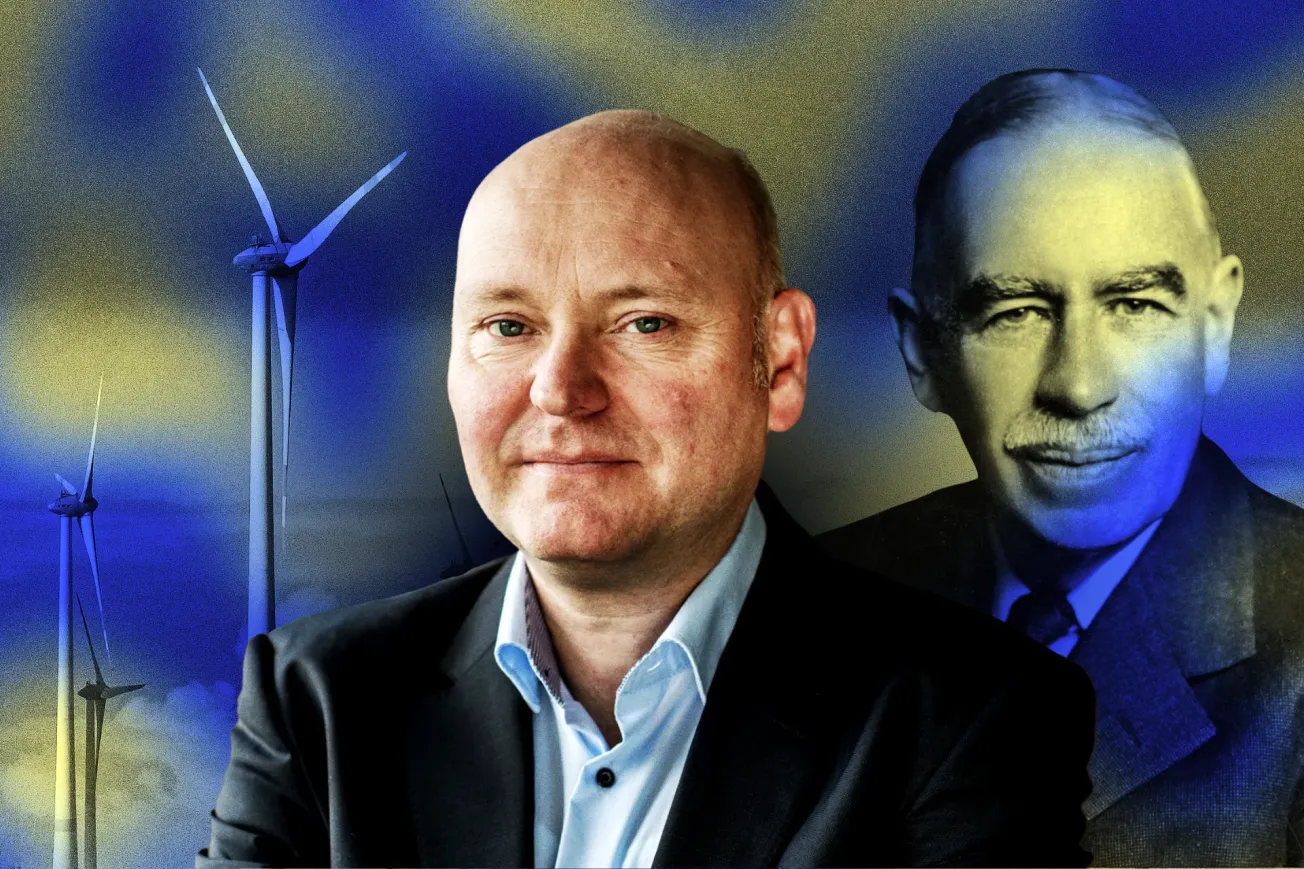In nur drei Monaten brachte SPD-Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bereits zwei komplette Haushaltsentwürfe samt neuem Finanzplan durch das Bundeskabinett. Die gute Nachricht: Die Haushalte 2025 und 2026 sind – auch dank Reform der Schuldenbremse und Sondervermögen für Infrastruktur und Klima – durchfinanziert. Die öffentlichen Investitionen wachsen kräftig, die seit Jahren schwer gebeutelte Konjunktur bekommt einen kräftigen Anschub. Die schlechte Nachricht: Ab dem Haushalt 2027 klafft allein für die drei Jahre bis 2029 eine riesige Lücke von 172 Milliarden Euro im Finanzplan des Kernhaushaltes. Im Jahr 2027 fehlen 34 Milliarden Euro, 2028 sind es schon 64 Milliarden Euro und 2029 fehlen gar 74 Milliarden Euro. Der Finanzminister erging sich in Sparappellen, schloss jüngst auch Steuererhöhungen nicht aus, blieb dabei aber sehr vage.
Das Prinzip Hoffnung ist nicht die beste Strategie
Die Hauptstrategie scheint denn auch im Wesentlichen noch im Prinzip Hoffnung zu bestehen, ein höheres Wirtschaftswachstum soll helfen. So erklärt die Pressemeldung des Bundesfinanzministeriums »Der wesentliche Ansatz ist stärkeres Wachstum. [...] Damit werden auch die Einnahmen des Staates gesichert und erhöht.« Tatsächlich würde höheres Wachstum helfen. Nach einer üblichen Faustformel verbessert sich die Haushaltssituation des Bundes um gut 2 Milliarden Euro, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 10 Milliarden Euro zunimmt, größtenteils bedingt durch höhere Steuereinnahmen. Klar ist auch, dass sich die Konjunktur zuletzt leicht verbessert hat und dass die vielen Milliarden für Infrastruktur und Rüstung der Konjunktur einen zusätzlichen Schub verleihen dürften.
So lagen einige Wachstumsprognosen bereits bei 0,4 Prozent und 1,7 Prozent für 2025 und 2026, während die Bundesregierung nur von 0 Prozent und 1,0 Prozent ausging. Damit könnte das BIP 2026 insgesamt schon um gut 1 Prozent höher liegen als bislang von der Bundesregierung unterstellt. Wenn man annimmt, dass das potenzielle BIP bis zum Jahr 2029 jedes Jahr um 1 Prozentpunkt stärker wächst als angenommen, läge das BIP im Jahr 2027 um 2 Prozent und 2029 um 4 Prozent höher als angenommen. Nach der Faustformel könnte das die Finanzlage des Bundes um 19 Milliarden Euro im Jahr 2027 und um 40 Milliarden Euro im Jahr 2029 verbessern.
Das wäre eine sehr erhebliche Verbesserung, würde die riesige Finanzlücke jedoch bloß um etwas mehr als die Hälfte schließen. Und das ist schon eine eher optimistische Rechnung, bei der bis zum Jahr 2029 keine größeren konjunkturellen Störungen auftreten dürften. Natürlich ist es auch nicht völlig ausgeschlossen, dass alles noch viel besser kommt, vielleicht gibt es auch noch ein paar Puffer in der Finanzplanung, und am Ende könnte sich alles in Wohlgefallen auflösen. Doch davon auszugehen, hieße in der Tat, allein auf das Prinzip Hoffnung zu setzen.
Insofern ist tatsächlich eine Debatte darüber notwendig, wie die aller Wahrscheinlichkeit in erheblicher Größe fortbestehende Haushaltslücke perspektivisch geschlossen werden kann. Die progressiven Parteien – vor allem die SPD in Regierungsverantwortung – dürfen dabei das Feld nicht den Strukturreform- oder Kettensägen-Fanatikern überlassen. Diese vertreten nur das vermeintliche Patentrezept aus Deregulierung, Schwächung von Arbeitnehmerrechten und Gewerkschaften, Kürzungen bei öffentlicher Daseinsvorsorge und vor allem Sozialabbau. Woher kommt die Haushaltslücke?
Ihnen zufolge ist die Haushaltslücke Ausdruck eines überbordenden Staates, der schon seit Langem über seine Verhältnisse lebt, und der nun endlich radikal zurechtgestutzt werden müsse. Eine solche Kürzungspolitik wäre jedoch gesamtwirtschaftlich schädlich, würde die soziale und politische Polarisierung weiter vorantreiben und damit möglicherweise am Ende die Demokratie gefährden. Würde sich die SPD an einer solchen Politik beteiligen, wäre es vermutlich auch das Ende der SPD als politisch relevanter Kraft in der Bundesrepublik. Offensichtlich muss ein anderer Ansatz her, der den Sozial- und Wohlfahrtsstaat entschieden verteidigt und sich für den Wohlstand der großen Mehrheit der Bevölkerung einsetzt, die auf eben jenen Staat und seine Daseinsvorsorge wesentlich angewiesen ist.
Die Kolumne »Eine Frage des Geldes« von Achim Truger direkt ins Postfach bekommen:
Ansatzpunkt sollte die Frage sein, woher eigentlich die nun beklagte Haushaltslücke kommt. Ehrlicherweise beruht sie zum Teil tatsächlich auf fragwürdigen Leistungsausweitungen, beispielsweise bei Mütterrente, Senkung der Gastromehrwertsteuer und der Erhöhung der Pendlerpauschale. Sie beruht aber auch auf dem Investitionsbooster aus verbesserten Abschreibungsbedingungen und der Senkung der Körperschaftsteuer zur Überwindung der langanhaltenden Wirtschaftskrise. Vor allem aber handelt es sich um höhere Zinskosten aufgrund der krisenbedingt höheren Staatsverschuldung, etwa durch vorgesehene Tilgungen von Corona- und Energiekrisenkrediten bei gleichzeitig gestiegenen Zinssätzen. Die Zinskosten steigen bis 2029 um über 32 Milliarden Euro, dazu kommen Schuldentilgungen von 9 Milliarden Euro, zusammen also über 41 Milliarden Euro, mehr als die Hälfte der Haushaltslücke von 74 Milliarden Euro in diesem Jahr. Mit anderen Worten: Ein ganz wesentlicher Teil der Haushaltslücke besteht aus Zins- und Tilgungskosten der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- und der Energiekrise sowie aus der Behebung der verteidigungs- und infrastrukturpolitischen Versäumnisse, die nun von der Bundesregierung angegangen werden.
Vermögensabgabe und Krisen-Soli
Offensichtlich handelt es sich bei der bevorstehenden Aufgabe der Haushaltskonsolidierung also viel weniger um das notwendige Zurechtstutzen eines überbordenden Staates. Es handelt sich vielmehr um die Verteilung der Lasten, die von den Großkrisen der Vergangenheit und den großen Herausforderungen der Zukunft ausgehen. So gesehen wäre es vollkommen unverständlich, wenn diese Lasten einseitig durch Leistungskürzungen bei der Masse der Bevölkerung oder besonders vom Sozialstaat abhängigen Menschen abgeladen würden, während Einkommensstarke und Wohlhabende durch die Unternehmenssteuersenkungen entlastet würden. Gerade auch angesichts der Tatsache, dass von vielen in den gesellschaftlichen Eliten aufgrund der Großkrisen fast schon rituell das »Wir« beschworen wurde, das diese Krisen zu bewältigen habe, wäre offensichtlich eine solidarische Finanzierung der Lasten über die Einnahmenseite plausibel und gerecht.
Maßnahmen wären sinnvoll, mit denen konkret für den Bund in sozial gerechter Weise ein erhebliches Mehraufkommen von zum Beispiel 20 Milliarden Euro jährlich erzielt werden könnte. Sinnvoll wären etwa eine Vermögensabgabe oder ein Krisen-Solidaritätszuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer. Gerade letzterer könnte schnell und unbürokratisch erhoben und an sich möglicherweise ändernde Bedarfe angepasst werden. Er könnte relativ gezielt auf die oberen 5 bis maximal 10 Prozent der Einkommensverteilung zugeschnitten werden und würde insofern tatsächlich solidarisch von den starken Schultern getragen. Je nach Größe der tatsächlich existierenden Haushaltslücke könnte das am Ende zu wenig sein, der Krisen-Soli wäre jedoch ein wesentliches Element einer Anti-Kettensägen-Strategie.