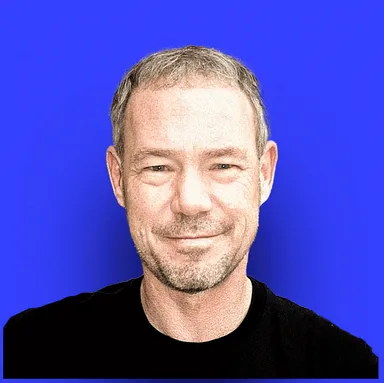In seiner berüchtigtsten (und am meisten missverstandenen) Polemik Zur Genealogie der Moral vertrat Friedrich Nietzsche die Ansicht, dass die Moral, wenn sie eine Frage des Nachdenkens über das sei, was wir einander schulden, ihren Ursprung in dem Moment habe, in dem wir durch wirtschaftliche Transaktionen gezwungen werden, von den Unterschieden zwischen ungleichen Dingen zu abstrahieren und Gleichwertigkeit zu behaupten, wo diese nicht gegeben ist. An dieser Stelle sei das Geld – für Karl Marx die universelle Ware – zu dem Mechanismus geworden, der den routinemäßigen Austausch zwischen Fremden ermöglichte.
Nietzsche begann seine Abhandlung mit einer rhetorischen Frage: »Haben sich diese bisherigen Genealogen der Moral etwa auch nur von Ferne etwas davon träumen lassen, dass zum Beispiel jener moralische Hauptbegriff ›Schuld‹ seine Herkunft aus dem sehr materiellen Begriff ›Schulden‹ hat?« Seine Antwort war nachdrücklich:
»Das Gefühl der Schuld, der persönlichen Verpflichtung, um den Gang unsrer Untersuchung wieder aufzunehmen, hat, wie wir sahen, seinen Ursprung in dem ältesten und ursprünglichsten Personen-Verhältniss, das es giebt, gehabt, in dem Verhältniss zwischen Käufer und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner ... [Man langte] alsbald bei der grossen Verallgemeinerung an ›jedes Ding hat seinen Preis; Alles kann abgezahlt werden‹ – dem ältesten und naivsten Moral-Kanon der Gerechtigkeit, dem Anfange aller ›Gutmüthigkeit‹, aller ›Billigkeit‹, alles ›guten Willens‹, aller ›Objektivität‹ auf Erden.«
Und es gab eine noch größere Auswirkung:
»Preise machen, Werthe abmessen, Äquivalente ausdenken, tauschen – das hat in einem solchen Maasse das allererste Denken des Menschen präoccupirt, dass es in einem gewissen Sinne das Denken ist ...«
Nietzsche verortete diesen Ursprung in der Antike, als das Geld erfunden wurde, und ermutigte damit zeitgenössische Gesellschaftstheoretiker wie Werner Sombart zu der Behauptung, dass der Kapitalismus ein transhistorisches Phänomen sei – und nicht, wie Marx behauptete, eine radikale Abkehr von früheren, weniger dynamischen Produktionsweisen. Derweil schrieb Max Weber ein komplettes Buch, das darauf zielte, Sombarts Position zu diskreditieren. Er argumentierte nicht nur, dass das Aufkommen des Kapitalismus ein relativ junges Phänomen sei, sondern auch, dass seine Entwicklung bestimmte Grenzen für die Bandbreite der Warenform voraussetze. »›Erwerbstrieb‹, ›Streben nach Gewinn‹, nach Geldgewinn, nach möglichst hohem Geldgewinn hat an sich mit Kapitalismus gar nichts zu schaffen«, schrieb Weber in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus:
»Dies Streben fand und findet sich bei Kellnern, Ärzten, Kutschern, Künstlern, Kokotten, bestechlichen Beamten, Soldaten, Räubern, Kreuzfahrern, Spielhöllenbesuchern, Bettlern: – man kann sagen: bei ›all sorts and conditions of men‹, zu allen Epochen aller Länder der Erde, wo die objektive Möglichkeit dafür irgendwie gegeben war und ist. Es gehört in die kulturgeschichtliche Kinderstube, daß man diese naive Begriffsbestimmung ein für allemal aufgibt. Schrankenloseste Erwerbsgier ist nicht im mindesten gleich Kapitalismus, noch weniger gleich dessen ›Geist‹. Kapitalismus kann geradezu identisch sein mit Bändigung, mindestens mit rationaler Temperierung, dieses irrationalen Triebes.«
Webers ehrgeizigeres Projekt – die Messung des durch die Reformation hervorgerufenen Wandels innerhalb des moralischen Klimas (ein in der Tradition von Hegel und Marx stehendes Vorhaben) – folgte logisch aus dieser Einsicht. Die Protestanten behandelten die Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden und den daraus resultierenden Fluch der Arbeit als Voraussetzung für die Erlösung: Ein Beruf (im Sinne von Berufung) wurde zur Voraussetzung des Zustands der Gnade, ein »heilsbringender Sündenfall« (felix culpa) hinein in eine Welt, in der Arbeit im Schweiße seines Angesichts mehr bedeutete als lediglich die Unterwerfung unter die Notwendigkeit.
Wie Hegel das Ergebnis erklärte, habe die »Arbeitslosigkeit hat nun auch nicht mehr als ein Heiliges gegolten«. Weber seinerseits war noch deutlicher. Nachdem er eingeräumt hatte, dass es bereits vor der Reformation bei feierlichen Anlässen eine »Schätzung der weltlichen Alltagsarbeit« gegeben habe, erklärte er: »Unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins: die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne.«
Die Tugend des Marktes
Die große Einsicht, die diesen Geschichtsphilosophen gemeinsam war, entstammte selbst einem modernen, mehr oder weniger protestantischen Empfinden: die Vorstellung, dass das Verhalten in der bürgerlichen Gesellschaft, die Teilnahme am Markt, die routinemäßige wirtschaftliche Tätigkeit, ja, sogar die notwendige Arbeit die eigentlichen Schauplätze der Moral seien, an denen die neuen bürgerlichen Tugenden der Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Sorgfalt, harten Arbeit und so weiter gezeigt, bewertet und belohnt werden könnten. (Im Gegensatz dazu konnten sich die antiken Denker und ihre machiavellistischen Erben, darunter Hannah Arendt, Sheldon Wolin, Tom Hayden und Alasdair MacIntyre, Moral nicht losgelöst von politischem Engagement vorstellen: Nach ihrer aristotelischen Auffassung war ein Individuum mit der Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen, per definitionem ein Bürger.)
Aus protestantischer Sicht waren das Heilige und das Profane zwar sicherlich getrennte Sphären, aber der Unterschied zwischen ihnen war nicht die Entfernung zwischen Himmel und Erde, denn die Gläubigen erlebten das Leben auf der Erde nicht mehr als Zeit der Bewährung vor der Ankunft des Herrn. Immanenz und Transzendenz waren nun kameradschaftliche Zeitgenossen, keine Momente in einer Abfolge oder die Bedingungen einer Entweder-oder-Entscheidung, denn Freiheit bedeutete nun nicht Befreiung oder Enthaltung von weltlichen, materiellen Umständen, sondern die gezielte Umgestaltung dieser Umstände durch Arbeit.
Das Reich Gottes war also zum Greifen nah, in Reichweite der Lebenden. Der im frühen 19. Jahrhundert lebende Literaturkritiker und Philosoph Friedrich Schlegel formulierte es so: »Der revolutionäre Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren, ist der elastische Punkt der progressiven Bildung und der Anfang der modernen Geschichte.«
Kritische Theorien
Der Rückblick auf diese Geistesgeschichte erinnert daran, dass Märkte einst als Schmelztiegel der Moral verstanden wurden und nicht als Ort der Verderbtheit und Auflösung, an dem Seelen ge- und verkauft werden, wie die Linke noch immer zu glauben scheint. Sicherlich bleibt »der Markt« heiliger Boden, aber er ist zu einem umstrittenen Terrain geworden.
Für Neoliberale ist der Markt der Ort der Freiheit – jedoch nur insofern, als der Staat nicht im Namen von sozialer Gerechtigkeit oder Chancengleichheit eingreift. Für Populisten ist der Markt die Quelle der Gleichheit – jedoch nur insofern, als das Kartellrecht die Freiheit großer Konzerne einschränkt, monopolistische Macht auszuüben. So oder so erfüllt der Markt seine gottähnliche, beinahe vorsehungshafte Bestimmung nur in dem Maß, in dem er als für Manipulation unempfängliches Gebilde erscheint: ein sich selbst regulierendes System anonymer Kräfte, das sich rationaler Steuerung oder Planung entzieht.